
NachDenkSeiten – Die kritische Website
Titel: Mathias Bröckers: „Alternative Medien müssen als investigative Intensivstation dagegenhalten“
Datum: 16. September 2018 um 11:45 Uhr
Rubrik: Audio-Podcast, Aufbau Gegenöffentlichkeit, Gedenktage/Jahrestage, Interviews, Medien und Medienanalyse, Medienkritik
Verantwortlich: Redaktion
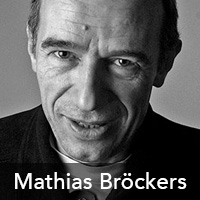
Ist die taz, wie die Grünen, zu einer Art FDP mit Fahrrad geworden? „Dafür haben wir die taz nicht gegründet“, sagt Mathias Bröckers im Interview mit den NachDenkSeiten. Bröckers gehört zur Gründergeneration der taz und er hat sich zum 40. Jubiläum des Blattes tief durch das Archiv der Zeitung für die Zusammenstellung eines Jahresbands gewühlt. Im Interview betont er, dass sich im Hinblick auf die Notwendigkeit alternativer Medien seit Gründung der taz nicht viel geändert hat. Selbsternannte Qualitätsmedien, so Bröckers, orchestrierten eine „Kriegslüge nach der anderen“. Da seien alternative Medien, die Gerüchte chirurgisch präzise von Fakten trennen, dringend notwendig. Ein Interview über die Gründungsjahre der taz, die Entwicklung des Blattes und darüber, was ein gutes journalistisches Produkt heute leisten muss. Von Marcus Klöckner.
Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.
Podcast: Play in new window | Download
Die „alternative“ Tageszeitung taz feiert 40. Jubiläum. Sie waren Gründungsmitglied und haben sich gerade für ein Buchprojekt durch das Archiv der taz gewühlt. Was war das für eine Zeitung, als sie an den Start ging?
„Wir haben keine Chance, aber wir nutzen sie“, war das Motto der ersten Nullnummer, die im September 1978 erschien – zu einer Zeit, als außer der taz noch eine weitere Tageszeitung aus der linken Ecke im Entstehen war – „Die Neue“ – die mit einigen professionellen Journalisten und etwas Geld startete. Dem „Sponti-Projekt“ taz, das ohne Kapital und journalistisches Know How an den Start ging – unter den etwa 50 Gründerinnen und Gründern hatte kaum eine Handvoll schon einmal eine Redaktion von innen gesehen – traute kein „Experte“ mehr als einen kurzen Sommer zu. Doch den überlebte „Die Neue“ dann nicht. Die taz aber hatte das Crowdfunding erfunden, bevor es das Wort dafür gab: 1534 Vertrauensselige bezahlten Anfang November 1978 ihr Vorausabo für eine Tageszeitung, die es noch gar nicht gab. Ein halbes Jahr später erschien sie und lebte und wirtschaftete in den ersten zehn Jahren mit und von diesem Vertrauensvorschuss ihrer Abonnenten – und den gab es, weil sich die frühe taz weniger als journalistisches, sondern als politisches Projekt verstand. Das wird auch aus dem Buch über die letzten 40 Jahre Zeit- und Zeitungs-Geschichte, das wir gerade zusammengestellt haben, sehr deutlich. Niemand kam zur taz, weil er nur einen Job suchte – die gab’s anderswo und deutlich besser bezahlt Ende der 70er ja noch überall.
Also gab es offensichtlich Bedarf an einem „alternativen“ Medium?
Der „Deutsche Herbst“ 1977 und die Hysterie angesichts des RAF-Terrors hatte ja zu einer regelrechten Gleichschaltung der Medien geführt. Wer mit längeren Haaren und Lederjacke in einem 2 CV mit Anti-AKW-Aufkleber herumfuhr, war damals quasi schon Terror-Sympathisant und wurde von der Polizei entsprechend behandelt. Friedliche Proteste gegen Atomkraftwerke wurden generalstabsmäßig niedergeknüppelt, es war, wie ein Filmtitel lautete, eine „bleierne Zeit“. In vielen Regionen entstanden alternative Stadtzeitungen, die aus anderer Perspektive und aus Sicht der Betroffenen berichteten. In Frankfurt waren das zum Beispiel der „Informationsdienst für unterbliebene Nachrichten“ und der „Pflasterstrand“ und in Berlin hatte sich im Umfeld des „Tunix“-Kongresses eine Initiativgruppe gebildet, mit Christian Ströbele als juristischem Berater und Manager, und aus diesen Initiativen entstand dann die taz. „Objektivität – nein Danke!“ lautete die erste These im „Prospekt Tageszeitung“, mit dem sich das Projekt erstmals vorstellte und um Vorausabos warb. Es ging nicht um Ausgewogenheit, sondern um Parteilichkeit – für die Befreiungsbewegungen in Lateinamerika, für die Frauenbewegung, für Ökologie, für Hausbesetzungen statt Kahlschlagsanierung, für Abrüstung statt „Pershing 2“, kurz: für Alternativen zum Bestehenden.
Durch das Internet gibt es heute eine Vielzahl an alternativen Medien und Formaten. Da scheint es einen zeitübergreifenden Bedarf zu geben, oder?
Den gibt es selbstverständlich, weil sich seit den 1970er Jahren wenig geändert hat an grundsätzlichen Strukturen und Problemen. Alternativen zur Destruktivität unseres Finanz- und Wirtschaftssystems sind notwendiger denn je – und sie aufzuzeigen und in die Köpfe zu bringen, wäre Aufgabe der alternativen Medien. Eigentlich auch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der als vierte Säule der Demokratie verfassungsgemäß zur Kontrolle der Politik und der Macht berufen ist, in der Regel aber nur noch als ihr Lautsprecher fungiert. Und da der Rest der Medien, der in Privatkonzernen zwecks Gewinnmaximierung agiert, letztlich auch nur Lautsprecher sein darf, ist der Bedarf an alternativen Non-Profit-Medien ohne Frage mehr als gegeben. Von daher eindeutig: Ja, wir brauchen alternative Medien! Die taz hat ihren Mitarbeitenden stets sehr magere Löhne gezahlt und nur überlebt, weil sie sich 1991 als Genossenschaft organisierte, deren Ziel nicht eine jährliche Rendite ist, sondern jeden Morgen eine gute Zeitung. Nur mit einer solchen Gemeinschaft konnte die Zeitung 40 Jahre durchhalten – und ohne eine solche Gemeinschaft im Rücken kann auch in Zukunft kein unabhängiges Medium existieren.
Welche Überschneidungen und Unterschiede zwischen der taz von damals und alternativer Medien von heute sehen Sie?
Die Reichweite, die das Netz heute bietet, hätten wir uns damals natürlich gewünscht. Die taz war dann zwar als erste deutsche Tageszeitung im „weltweiten Computerverbund Internet“ (O-Ton 1995) digital verfügbar, aber auch kein Profiteur der Dotcom-Blase. Im Vergleich zur taz-Gründung und dem Aufwand, eine Zeitung zu drucken und auszuliefern, herrschen ja heute, was die Verbreitung von Nachrichten betrifft, geradezu paradiesische Zustände. Was aber die Erstellung von Nachrichten betrifft, hat sich wenig geändert: Guter Journalismus bedeutet Aufwand, produziert Kosten und ist nicht umsonst zu haben. Und wer nicht zum Lautsprecher irgendeines Profiteurs werden und unabhängig berichten will, kommt ohne eine „Community“, am besten eine Genossenschaft, die diese Unabhängigkeit finanziert, nicht aus. Das gilt für alles und jeden, die sich mit Nachrichten jenseits des Mainstreams zu Wort melden.
Können Sie uns einen Einblick in den Alltag der taz von damals geben? Wie ging es damals in der Redaktion zu?
Die taz verstand sich als Kollektiv, das sich einen Einheitslohn von 800 DM für Hand-und Kopfarbeit auszahlte und alle grundlegenden Entscheidungen auf einer wöchentlichen Kollektivsitzung traf. Weil aber nie alle einer Meinung waren und mehrheitlich entschieden wurde, gab es immer Fraktionen und Interessengruppen, die unterschiedliche Ziele verfolgten. Wenn bei den morgendlichen Redaktionskonferenzen der begrenzte Raum auf den Seiten aufgeteilt werden musste, gab es oft heftige Diskussionen. Von verschiedenen externen Aktivisten, die ihre Anliegen in der taz nicht vertreten sahen, wurde die Redaktion dann auch häufiger besetzt. „taz lügt!“ war schon lange vor dem Stigma „Lügenpresse“ eine verbreitete Parole an Kreuzberger Hauswänden, wo die meisten tazlerInnen lebten. Den Autonomen war die taz nicht militant genug, den linken, kommunistischen Gruppen war sie zu undogmatisch, sowohl der Stasi als auch dem Verfassungsschutz war sie nicht geheuer und sie platzierten dort ihre Spitzel. Dass aus all dem Chaos täglich eine Zeitung entstand, ist eigentlich ein Wunder. Die frühe taz war ein Labor für viele Debatten und Ideen, die im Mainstream erst viele Jahre später ankamen – eine Frauenquote zum Beispiel wurde nach einem Streit um sexistische Texte schon 1980 beschlossen, Ökologie und nachhaltige Wirtschaft waren von Beginn an ein Thema und nach der Tschernobyl-Katastrophe 1986 verdoppelten sich die Abos in kurzer Zeit. So anstrengend und nervig dieses hierarchiefreie, kollektivistische Arbeiten auch war, so hatte dieses Kollektiv doch erstaunliche seismographische Fühler für sehr viele gesellschaftliche Problemfelder. Dass sich daraus schon aus Gründen der Effizienz dann flache Hierarchien entwickelten und Chefredaktion und Ressortleitungen eingeführt wurden, hat die Arbeit an der Zeitung zwar durchaus erleichtert, die unter dem Stichwort „Professionalisierung“ vorangetriebenen Änderungen führten aber auch zur einer Normalisierung der Inhalte. Ähnlich wie die „Grünen“, die ihre radikalen und pazifistischen Prinzipen erst kappen mussten, um an politische Positionen zu kommen, verabschiedete sich auch die taz schrittweise von ihren Wurzeln, wurde „realpolitisch“ und durfte dann irgendwann auch im „Presseclub“ mitspielen.
Und heute? Wie sieht es heute in der Redaktion aus?
Ich habe die Redaktion Anfang der 90er Jahre verlassen, weil ich selbst mehr schreiben wollte, statt jeden Tag das Feuilleton zu machen und Texte von anderen zu redigieren; seit 2006 berate ich den taz-Verlag in Sachen digitale Transformation, bin aber kein Mitglied der Redaktion und habe dort keine tieferen Einblicke. Als ich bei einer Strategie-Runde einmal vorschlug, wir sollten die nächsten zehn freiwerdenden Redaktionsstellen mit Leuten besetzen, die NICHT von Journalistenschulen kommen, erntete ich viele böse Blicke, weil viele wohl solche besucht haben. Mein Vorschlag richtete sich aber gar nicht gegen diese Einrichtungen, da kommen ja viele kluge und nette Journalisten raus, du kannst sie heute im Sport-Ressort, morgen bei der Kultur und übermorgen als Wirtschaftsredakteur einsetzen und nirgends schreiben sie wirklichen Unsinn. Aber sie schreiben auch nichts wirklich Gutes, weil sie für nichts brennen und eigentlich kein Thema haben, das sie wirklich interessiert. Sie haben einfach nicht mehr so die Wut und die Verve im Bauch wie die Gründergeneration der taz – und ein wenig von diesem Elan, dachte ich, könnte die aktuelle taz jetzt brauchen.
Warum haben Sie sich aus der Redaktion zurückgezogen?
Wie gesagt, wollte ich selbst lieber Autor als Redakteur sein und habe dann auch noch bis 1996 eine wöchentliche Kolumne für die taz geschrieben. Als Rot-Grün dann in den Balkankrieg zog und weite Teile der Redaktion da mitmarschierten, wurde meine Sympathie für die Zeitung auf eine schwere Probe gestellt – und das wird sie nach wie vor. Aber dennoch ist die taz nach wie vor eine Tageszeitung wie keine andere und in mancher Hinsicht sogar die beste von allen.
Das sagen Sie jetzt aber nicht, um sich bei der taz Bonuspunkte zu verdienen, oder?
Nö, die sind doch schon längst alle beisammen – als Herausgeber einer 800-seitigen Chronik der taz zum 10. Geburtstag 1989 und jetzt mit diesem prächtigen Band zum 40. liege ich schon weit über dem Soll. Leider zahlen sich aber taz-Bonuspunkte nicht in irgendwelchen Betriebsrenten aus. Deshalb wird bei der nächsten Genossenschaftsversammlung über einen Fonds für Mitarbeitende abgestimmt, die mehr als 30 taz-Jahre auf dem Buckel haben und dann nur eine lachhaft geringe Rente beziehen. Der wird sicher eine Mehrheit finden und vielleicht ja auch die Jüngeren in der Redaktion motivieren, gegen den Rentenbetrug und das neoliberale Schweinesystem insgesamt endlich mehr auf den Putz zu hauen. Als selbstverwaltetes, genossenschaftliches Unternehmen hat die taz eine viel größere Unabhängigkeit und Freiheit als die meisten anderen Zeitungen und Medienorgane – aber sie nutzt sie viel zu wenig. Und dafür, wie die Grünen nur zu einer Art FDP mit Fahrrad zu werden, dafür – um einen im Hause verbotenen Satz zu verwenden – „haben wir die taz nicht gegründet“.
Vor kurzem wurde bekannt, dass die taz ab 2022 nur noch am Wochenende in gedruckter Form erscheinen soll. Ist das ein weiterer Hinweis für den großen Umbruch in der Medienwelt?
Dass die Medienwelt insgesamt und die Tageszeitungen im Besonderen sich in einem großen Umbruch befinden, ist offensichtlich. Wer sich die Entwicklung der verkauften Auflage und der Abonnements von Tageszeitungen anschaut, kann das nicht übersehen. Der Marktführer Bild hat seit 1998 mehr als 63 % seiner Auflage verloren, bei den anderen Tageszeitungen geht es nicht ganz so dramatisch, aber ebenfalls rapide bergab. Und es ist überhaupt nicht abzusehen, dass sich dieser Trend noch einmal umkehren wird und wieder mehr Zeitungen abonniert oder am Kiosk gekauft werden. Das Geschäftsmodell der gedruckten Zeitung – den Platz zwischen den bezahlten Anzeigen mit „Informationen“ zu füllen – geht seinem Ende entgegen. Dass die taz ab 2022 werktags nicht mehr erscheinen soll, ist aber keineswegs ausgemacht.
Sondern?
Vielmehr hat der Geschäftsführer Kalle Ruch für die kommende Genossenschaftsversammlung der taz zur Debatte gestellt, dass eine taz mit weniger als 20.000 gedruckten Abonnements sich schlicht nicht mehr rechnet und ein permanentes Zuschussgeschäft wäre. Aktuell schreibt die taz eine schwarze Null, hat noch 26.000 Abonnenten und eine etwa doppelt so hohe Druckauflage, aber die Tendenz ist fallend. In dieser Situation denkt die Geschäftsführung in weiser Voraussicht über Alternativen nach – und eine dieser Alternativen wäre die Einstellung der gedruckten Werktagsausgabe, die Transformation der Abonnements in digitale Abos und eine erweiterte, gedruckte Wochenend-taz. Darüber wird die taz-Genossenschaft am 15. September diskutieren – aber es liegt keine Beschlussvorlage vor, die abgestimmt wird. Die stets sensationsheischenden Medien haben aus diesem internen Diskussionspapier dann gleich „taz stirbt 2022“ und ähnliche Fake-News gebastelt. Tatsächlich denkt die taz nur als Erste über mögliche Szenarien des Überlebens nach, und um solche Überlegungen werden alle anderen Presseerzeugnisse auch nicht herumkommen.
Wie müsste denn aus Ihrer Sicht heute ein Medium aussehen, das vielleicht mit einer vergleichbaren Grundeinstellung in die Medienwelt treten würde, wie es bei der taz der Fall war? Und: Was müsste oder sollte dieses Medium leisten?
It’s still the same: Aufklärung, Bewusstseinserweiterung, Verbreitung unterbliebener Nachrichten, Gegenöffentlichkeit, Whistleblowing, demokratische Kontrolle der Autorität und der Macht. Letztlich genau das, was echter Journalismus leisten soll, aber kaum noch tut – und sich dann wundert, dass das Misstrauen des Medienpublikums stetig wächst. Dass nun die sozialen Medien als Sündenbock und Biotop für „Fake-News“ gekürt werden, wird an diesem Vertrauensschwund nichts ändern, denn nicht die Schneeballeffekte der Postings von Kreti und Pleti sind die Gefahr, es sind die Fake News der selbsternannten „Qualitätsmedien“, die eine Kriegslüge nach der anderen orchestrieren. Und wo in den offiziellen Gerüchteküchen zunehmend Spindoktoren am Werk sind, die Verwirrung und Vernebelung stiften bzw. FUD – Fear, Uncertainity & Doubt (Angst, Unsicherheit und Zweifel) – produzieren, wie es in der Sprache der Werbestrategen heißt, müssen alternative Medien als investigative Intensivstation dagegenhalten. Also Gerüchte und Tatsachen, Behauptungen und Fakten auf chirurgische Weise trennen und wenn Staat und Behörden unter dem Regime von FUD Beweismaterial zurückhalten, dieses notfalls gerichtlich einfordern. Einer solchen Presse, die im Idealfall ihren faktengesättigten Nachrichtenteil von dem mit den Meinungen und Kommentaren vollkommen trennt, sodass man letzteren mit den Werbeprospekten ggf. gleich entsorgen kann, würden die “hearts and minds” sowie die Abonnements mit Sicherheit wieder zufliegen. Journalisten müssten nicht fürchten, künftig überflüssig zu werden wie einst die Heizer auf der Elektrolok, wenn sie sich ihrer Wächterrolle wieder besinnen, für die ihnen in demokratischen Verfassungen auch besondere Rechte verliehen wurden. Weil ihnen als Auge, Ohr und Kontrollorgan des Souveräns – des Volks – besonderer Schutz gebührt – aber nicht, um als Stenographen der Macht und Lautsprecher der Eliten zu fungieren. Für eine solche Zeitung, da bin ich sicher, würden die Leute mit Freuden bezahlen. Und eine taz, die sich wieder auf diese Rolle als Watchdog besinnt, statt sich in Tinnef-Aktivismus zu verlieren, könnte sogar noch in zehn Jahren auf Papier erscheinen – weil die betagten (und betuchten) Genossinnen und Genossen genau das wollen.
Anmerkung: Mathias Bröckers gehört zur Gründergeneration der taz, war dort bis 1991 Kulturredakteur und bis 1996 Kolumnist. Seit 2006 berät er den taz-Verlag bei seiner digitalen Entwicklung. „40 Jahre taz – Das Buch“ erscheint am 15.9. im taz-Verlag. 400 Seiten, gebunden, Großformat, 40 Euro, ISBN 978-3-937683-72-0
Hauptadresse: http://www.nachdenkseiten.de/
Artikel-Adresse: http://www.nachdenkseiten.de/?p=46005