
NachDenkSeiten – Die kritische Website
Titel: 5 Thesen zum Streit um das „Hochschulzukunftsgesetz“ in NRW
Datum: 14. April 2014 um 10:10 Uhr
Rubrik: Hochschulen und Wissenschaft, Strategien der Meinungsmache
Verantwortlich: Wolfgang Lieb
- Ein Vergleich zwischen dem geltenden Recht und der Novelle zeigt: Beim Widerstand von Rektorinnen und Rektoren geht es vor allem um die Verteidigung deren Macht und deren Privilegien.
- Der hochschulpolitische Streit geht um die Verteidigung des Paradigmas der „unternehmerischen“ bzw. der „entfesselten“ Hochschule gegen das Leitbild einer demokratischen und sozialen Hochschule in gesellschaftlicher Verantwortung.
- Der Öffentlichkeit und sogar auch der Politik wird ein falsches Bild über die Stimmungslage an den Hochschulen vermittelt.
- Die behaupteten Erfolge der „unternehmerischen“, wettbewerbsgesteuerten Hochschulen sind sehr zweifelhaft.
- Der derzeit vorliegende Entwurf eines „Hochschulzukunftsgesetzes“ verbaut eher die Zukunft für eine wirkliche und notwendige Reform der Hochschulen. [*]
Von Wolfgang Lieb
1. These: Ein Vergleich zwischen dem geltenden Recht und der Novelle zeigt: Beim Widerstand von Rektorinnen und Rektoren geht es um die Verteidigung deren Macht und deren Privilegien
Bei dem heftigen Widerstand der Hochschulleitungen, der Vorsitzenden der Hochschulräte und den Vertretern der Wirtschaft gegen eine Novellierung des sog. Hochschul-„Freiheits“-Gesetzes geht es nicht (mehr) um eine sachliche Auseinandersetzung, sondern um die Verteidigung von Machtpositionen und von Privilegien der Leitungsgremien der Hochschulen.
„Seit 2006 sind Rektoren, Kanzler und Hochschulratsmitglieder in NRW so selbstbestimmt und privilegiert wie in keinem anderen Bundesland. Nirgendwo sonst können sie freier über Ausrichtung, Personal, Geldanlagen oder ihr Gehalt entscheiden. Wer sie aus diesem Arkadien vertreiben wollte, provozierte maximalen Widerstand der 37 zu allem entschlossenen Hochschulleiter.“
Das schreibt kein radikaler Studentenverband, sondern die konservative „Welt am Sonntag“ vom 23. März dieses Jahres.
Der Machtkampf von Seiten der Hochschulleitungen wird unter der Fahne der Autonomie geführt und als Freiheitskampf gegen Detailsteuerung durch die Ministerialbürokratie oder gar gegen „Planwirtschaft“ stilisiert. Siehe z.B. die Vorsitzende der Landesrektorenkonferenz (LRK) Ursula Gather: „Im Entwurf ist angelegt, dass das Ministerium bis ins kleinste Detail Vorschriften erlassen kann“.
Ich halte das für eine Phantomdiskussion und will das an wenigen Beispielen schwarz auf weiß belegen:
Ablehnung von „Rahmenvorgaben“:
„Wir lehnen das Instrument der Rahmenvorgabe weiterhin ab, da durch sie eine unverhältnismäßige Ausweitung der Befugnisse der Ministerialbürokratie erfolgt und faktisch die Fachaufsicht durch das Ministerium wieder eingeführt wird.“ Das sagt die Vorsitzende der LRK Ursula Gather in der schon zitierten WamS vom 23.03.14.
Das ist schon deshalb unglaubwürdig, weil weder Frau Gather noch die LRK nichts gegen eine Fachaufsicht durch ihre freischwebenden, niemand legitimationspflichtigen Hochschulräte haben, denen das geltende Gesetz Entscheidungskompetenzen und eine Aufsicht über die Hochschulen einräumt, wie sie Staat und Parlamente gegenüber Hochschulen seit den Humboldtschen Universitätsreformen nicht mehr hatten.
Ein Blick ins geltende Gesetz und ein Vergleich mit der Novelle (Fassung vom 23.03.2014 [PDF – 2.3 MB]), zeigen, dass der neue Gesetzentwurf für die Hochschulen freiheitsverbürgender und rechtssicherer ist.
Dabei geht es bei den Rahmenvorgaben – nebenbei bemerkt – keineswegs um inhaltliche Frage von Forschung und Lehre, sondern um ganz klassische Verwaltungsaufgaben.
Zu den von der LRK abgelehnten „Rahmenvorgaben“ heißt es de lege ferenda in § 6 Abs. 5:
Das Ministerium kann im Bereich der Personalverwaltung, der Haushalts- und Wirtschaftsangelegenheiten, des Gebühren-, Kassen- und Rechnungswesens sowie der Aufgaben der Berufsbildung nach dem Berufsbildungsgesetz (Bereich zugewiesener Aufgaben nach § 76a Absatz 1) nach Anhörung Regelungen treffen, die allgemein für Hochschulen in der Trägerschaft des Landes und nicht nur für den Einzelfall gelten (Rahmenvorgaben); Rahmenvorgaben sind für diese Hochschulen verbindlich. Der Erlass von Rahmenvorgaben steht ausschließlich im öffentlichen Interesse.
Im geltenden Gesetz heißt es in § 5 Abs. 9 HG :
„Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium erlässt das Ministerium Verwaltungsvorschriften zur Wirtschaftsführung und zum Rechnungswesen, zum Nachweis der sachgerechten Verwendung der Mittel sowie zum Jahresabschluss.“
Die Rektoren müssten doch eigentlich wissen, dass unter einer „Verwaltungsvorschrift“ – wie im geltenden Hochschulgesetz – eine innerbehördliche Regelung zu verstehen ist, die auf der dienstrechtlichen Gehorsamspflicht einer „nachgeordneten Behörde“ basiert und nur einer eingeschränkten verwaltungsgerichtlichen Kontrolle unterliegt.
Der Wechsel von einer „Verwaltungsvorschrift“ in die Begrifflichkeit der „Rahmenvorgabe“ drückt also, umgekehrt wie die Mathematikerin Ursula Gather meint, gerade die rechtliche Verselbständigung und die gleiche „Augenhöhe“ der Hochschulen gegenüber der Landesregierung aus.
Kritik an „Landeshochschulentwicklungsplänen“
Der Beweis, dass es um vorgeschobene Kampfrhetorik geht, die kaum etwas mit der Sache zu tun hat, lässt sich auch anhand der Kritik der Hochschulleitungen an einer Landeshochschulentwicklungsplanung führen.
In § 6 Abs. 1 des geltenden Gesetzes heißt es:
Zur Steuerung des Hochschulwesens entwickelt das Land strategische Ziele und kommt damit seiner Verantwortung für ein angemessenes Angebot an Hochschulleistungen nach. Auf der Grundlage dieser strategischen Ziele werden die hochschulübergreifenden Aufgabenverteilungen und Schwerpunktsetzungen und die hochschulindividuelle Profilbildung abgestimmt.
§ 6 in der Fassung vom 23.03.2014 lautet:
(1) Die Entwicklungsplanung des Hochschulwesens ist eine gemeinsame Aufgabe des Ministeriums und der Hochschulen in der Gesamtverantwortung des Landes. Diese Entwicklungsplanung dient insbesondere der Sicherstellung eines überregional abgestimmten Angebots an Hochschuleinrichtungen und Leistungsangeboten sowie einer ausgewogenen Fächervielfalt und besteht aus dem Landeshochschulentwicklungsplan und den einzelnen Hochschulentwicklungsplänen.
(2) Zur Steuerung des Hochschulwesens beschließt das Ministerium auf der Grundlage vom Landtag gebilligter Planungsgrundsätze den Landeshochschulentwicklungsplan als Rechtsverordnung im Benehmen mit dem Landtag und kommt damit der Verantwortung des Landes für ein angemessenes Angebot an Hochschulleistungen nach. Gegenstand des Landeshochschulentwicklungsplans können insbesondere Planungen betreffend ein überregional abgestimmtes und regional ausgewogenes Leistungsangebot, eine ausgewogene Fächervielfalt, die Studiennachfrage, die Auslastung der Kapazitäten sowie Fragen der Forschung sein. Für die Hochschulentwicklungsplanung ist der Landeshochschulentwicklungsplan verbindlich. Auf allen Stufen der Entwicklung des Landeshochschulentwicklungsplans werden die Belange der Hochschulen, insbesondere ihre Hochschulentwicklungspläne, angemessen berücksichtigt (Gegenstromprinzip). Das Ministerium berichtet dem Landtag über die Ausführung des Landeshochschulentwicklungsplans in der Mitte seiner Geltungsdauer.
Würde das geltende Gesetz ernst genommen und befolgt, dann wäre dieses für die Steuerung des Hochschulwesens wesentlich freiheitsfeindlicher und erlaubte nicht kontrollierbare staatliche Eingriffe viel eher als die jetzt vorgeschlagenen Regelungen.
Zugegebenermaßen sind solche „strategischen Ziele“ zur Steuerung des Hochschulwesens seit der Verabschiedung des Hochschul-„Freiheits“-Gesetzes in den zurückliegenden 8 Jahren nie bzw. allenfalls in Ansätzen entwickelt worden. Aber aus diesem politischen Versäumnis oder dem fehlendem politischen Willen zur Ausfüllung des derzeit geltenden Hochschulgesetzes ist doch noch lange kein Anspruch der einzelnen „unternehmerischen Hochschulen“ – quasi als Gewohnheitsrecht – erwachsen, sich einer Steuerung, ausgerichtet an strategischen Zielen einer Landeshochschulgesamtplanung, entziehen zu können. Dadurch, dass ein Gesetz bewusst oder fahrlässig nicht ausgefüllt worden ist, wurden doch keine übergesetzlichen Rechte auf die Hochschulen übertragen. Letztlich war die derzeitige widersprüchliche Gesetzeslage doch nur Ausdruck der erheblichen Steuerungsunsicherheit in der zurückliegenden Phase der Hochschulreform.
Die jetzt vorgesehene Regelung im Referentenentwurf ist nicht nur rechtlich bestimmter und damit freiheitsverbürgender als die derzeit geltende, sie verschafft endlich auch wieder dem Parlament gegenüber der Exekutive ein Mitbestimmungsrecht über – wohlgemerkt nur – „Planungsgrundsätze“ eines Landeshochschulentwicklungsplanes (§ 6 Abs. 2 Entwurf in der Fassung vom 23.03.2014).
Die im Gesetzentwurf vorgeschlagenen Regelungen sind vom Grundsatz her notwendig, z.B. um den Studierenden im Land ein ausgewogenes und leistungsfähiges Angebot an Hochschulen machen zu können, wozu der Staat u.a. schon aus Gründen der Freiheit der Berufswahl verpflichtet ist.
Zielvereinbarung vs. Hochschulverträge
Ein weiteres Schreckbild für die Hochschulrektoren scheint der Begriffswechsel von den bisher sog. „Zielvereinbarungen“ zu „Hochschulverträgen“ zu sein.
Um den Unterschied wenigstens grob zu skizzieren, ist es sinnvoll, noch einmal zu rekapitulieren, was „Zielvereinbarungen“ eigentlich von ihrer Rechtsnatur her sind:
Solche „Vereinbarungen“ sind im Zusammenhang mit der Modeerscheinung des sog. „New Public Managements“ in die öffentliche Verwaltung eingeführt worden. Zielvereinbarungen sollen einerseits ein prinzipiell gleichberechtigtes, jedoch mit unterschiedlichen Aufgaben und Funktionen ausgestattetes Verhältnis zwischen Staat und Hochschulen ausdrücken. In der Sache sollten solche „Vereinbarungen“ eine Abkehr von der staatlichen Verfahrenssteuerung zur Erreichung bestimmter Ziele hin zu einem „management by objectives“, also allein auf Leistungsziele bezogene Absprachen zwischen einzelnen Hochschulen und dem Ministerium sein. Die Zielerfüllung soll und kann erst zu einem festgelegten späteren Zeitpunkt überprüft werde. Wie die „strategischen Entwicklungsziele sowie konkrete Leistungsziele“ erreicht werden, sollte dem in seinen Durchgriffsrechten wesentlich gestärkten „Hochschulmanagement“ überlassen bleiben.
Lassen wir einmal beiseite, dass manche Zielvereinbarung geschlossen wurde, die weit über den Detailierungsgrad früherer staatlicher (Verfahrens-)Steuerungsinstrumente hinausging. Und lassen wir darüber hinaus einmal außen vor, dass damit keineswegs die Selbstverwaltungsrechte der Hochschule insgesamt gestärkt wurden, sondern vor allem die Entscheidungskompetenzen der Hochschulleitungen. Tatsächlich setzte man nämlich per Gesetz auf eine massive strukturelle Stärkung der Präsidien. Und deren Macht wurde noch zusätzlich durch einen freischwebenden Hochschulrat gestützt.
Unbestreitbare Tatsache ist jedenfalls, dass – wie schon der Name sagt – anzustrebende „Ziele“ für die Zukunft zwischen der einzelnen Hochschule und dem Ministerium abgesprochen wurden. Aber Papier ist bekanntlich geduldig. Zielvereinbarungen haben keine unmittelbar verbindliche rechtliche Qualität, sie sind weder einklagbar, noch gibt es klare Sanktionsregelungen, wenn die vereinbarten Ziele nicht erreicht worden sind. Man nimmt sich also bestenfalls gemeinsam etwas vor.
So wortreich die wunderbaren Ziele in dem gängigen betriebswirtschaftlichen Vokabular (Wettbewerb, Effizienz, Flexibilisierung, Modularisierung, Profilbildung, „Studienportfolio“, Internationalisierung, E-Learning) auch beschrieben wurden, die „objectives“ blieben meistens ziemlich diffus. Dementsprechend vage blieben in der Regel auch die Berichte der Hochschulen über die jeweilige Zielerreichung.
Bis heute ist bei den Ziel- und Leistungsvereinbarungen das Problem der Konsequenzen bei einer Nicht-Erfüllung von solchen Kontraktzusagen grundsätzlich nicht gelöst. Die Hochschulen haben es stets verstanden, die angeblich erreichten Ziele beschönigend zu beschreiben oder aber gute Gründe anzuführen, warum die Ziele nicht erreicht werden konnten. Es entspricht der allgemeinen Lebenserfahrung, dass höchst selten alle für die Zukunft verabredeten und erhofften Ziele (jedenfalls in Gänze) erreicht werden können, es hätte also zumindest eine beachtliche Zahl an Fällen geben müssen, wo das Verfehlen der vereinbarten Ziele zu irgendwelchen Konsequenzen hätte führen müssen. Davon ist nichts oder nur wenig bekannt.
Der Begriff „Vertrag“ drückt die Gleichberechtigung der „Vertragspartner“ (gleiche Augenhöhe) viel deutlicher aus als der frühere Begriff „Vereinbarung“.
Ein Fortschritt ist allerdings, dass die Vertragsgegenstände durch das geplante Gesetz künftig konkreter ausgestaltet werden sollen.
§ 6 Abs. 3 (Gesetzentwurf vom 23.03.2014)
(3) Das Ministerium schließt mit jeder Hochschule nach Maßgabe des Haushalts für mehrere Jahre geltende Hochschulverträge. In den Hochschulverträgen werden insbesondere vereinbart:
1. strategische Entwicklungsziele,
2. konkrete Leistungsziele oder konkrete finanziell dotierte Leistungen und
3. das Verfahren zur Feststellung des Standes der Umsetzung des Hochschulvertrages;
geregelt werden können auch die Folgen bei Nichterreichen hochschulvertraglicher Vereinbarungen.
Ablehnung von Sanktionen:
Die Vorsitzende der Landesrektorenkonferenz erregt sich in dem schon genannten Interview mit der WamS vor allem darüber, dass zukünftig das Ministerium „Teile der Haushaltsmittel der (!) Universitäten als Sanktion einbehalten“ können soll.
De lege lata § 6 Abs. 2 HG heißt es:
Die Ziel- und Leistungsvereinbarungen beinhalten auch Festlegungen über die Finanzierung der Hochschulen nach Maßgabe des Haushalts; insbesondere kann ein Teil des Landeszuschusses an die Hochschulen nach Maßgabe der Zielerreichung zur Verfügung gestellt werden.
De lege ferenda heißt es in § 6 Abs. 3 des neuen Gesetzentwurfs (vom 23.03.2014):
Nach Maßgabe des Haushalts beinhalten die Hochschulverträge auch Festlegungen über die Finanzierung der Hochschulen, insbesondere hinsichtlich des ihnen für die Erfüllung konkreter Leistungen gewährten Teils des Landeszuschusses; insbesondere kann geregelt werden, dass ein Teil des Landeszuschusses an die Hochschulen nach Maßgabe des Erreichens der hochschulvertraglichen Vereinbarungen zur Verfügung gestellt wird.
In der derzeit geltenden Gesetzesfassung kann also (einseitig durch das Ministerium) ein Teil des Zuschusses einbehalten werden; in der neuen Entwurfsfassung muss das vertraglich (also beidseitig) geregelt werden. Dass die Neuregelung hochschulfreundlicher ist als die derzeit geltende, müsste jeder erkennen, der nur einen vergleichenden Blick auf die Formulierungen geworfen hat.
Die Vorsitzende der LRK meint allerdings trotzig:
„Diese Mittel bekommen die Universitäten zur Erfüllung ihrer Aufgaben. Diese kann man ihnen nicht einfach wieder entziehen“.
Offenbar geht die Rektorin davon aus, dass die Hochschulen einen festen Anspruch auf die insgesamt 6 Milliarden Steuergelder haben, egal ob diese Landeseinrichtungen ihre vereinbarten Ziele erreichen oder nicht. So stellt man sich auf Seiten der Rektoren offenbar „Eigenverantwortung“ vor: man kassiert das Geld vom Staat ohne Rechenschaft über die eigenen Leistungen ablegen zu müssen und ohne Verantwortung dafür tragen zu müssen, wenn man die versprochenen Leistungen nicht erbringt.
Vulgär ausgedrückt: „Steuerzahler, schieb uns das Geld rüber, ansonsten kannst Du uns mal.“ Dass der Steuerzahler einmal antworten könnte: „Ihr Hochschulen könnt uns auch mal“, kommt den abgehobenen Repräsentanten der Hochschulen offenbar gar nicht mehr in den Sinn.
2. These: Der hochschulpolitische Streit geht um die Verteidigung des Leitbildes der „unternehmerischen“ bzw. der „entfesselten“ Hochschule
Diese These lässt sich am Kampf gegen die Transparenzregel für die Drittmittelforschung ganz gut belegen.
Da wurde geradezu ein Aufstand angezettelt, gegen eine Transparenzregelung, die zurückhaltender kaum sein kann: Das Präsidium soll „in geeigneter Weise“ die Öffentlichkeit insbesondere über Themen, den Umfang der Mittel Dritter sowie über die Drittmittelgeber informieren (so hieß es noch in § 71 a des ersten Referentenentwurf).
In einem Offenen Brief [PDF] an die Landesregierung sahen Vorsitzende der Hochschulräte die Wettbewerbsfähigkeit der nordrhein‐westfälischen Hochschulen und damit ihr nationales und internationales Ansehen und dazu gleich auch noch den Wirtschaftsstandort NRW gefährdet.
Den unterzeichnenden Hochschulratsvorsitzenden geht es also erkennbar nicht so sehr um die Wahrung einer freien Wissenschaft an den Hochschulen, ihnen geht es vielmehr – wie sie wörtlich schreiben – um den „Schulterschluss der Hochschulen mit Industrie und Wirtschaft“.
Insbesondere der Chef eines großen Automobilzulieferers und gleichzeitig Hochschulratsvorsitzender der Universität Siegen, Arndt G. Kirchhoff, aber auch die Wirtschaftslobby in Form der Industrie- und Handelskammern sowie der Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung Unternehmer NRW, Luitwin Mallmann, drohten mit dem Abzug und der Abwanderung von Forschungsmitteln der Wirtschaft von NRW-Hochschulen.
Wettbewerbsfähigkeit und Standortkonkurrenz, das sind die beiden ideologisch aufgeladenen Kampfbegriffe, die auch zum Leitbild für die „unternehmerische“ oder „entfesselte“ (Detlef Müller-Böling vom bertelsmannschen Centrum für Hochschulentwicklung (CHE)) Hochschule geworden sind. Deren Forschung und Entwicklung soll angesichts rückläufiger oder bestenfalls stagnierender staatlicher Grundmittel mehr und mehr durch den Wettbewerb um die Einwerbung zusätzlicher Drittmittel gesteuert werden.
Inzwischen machen die Drittmittel über ein Viertel teilweise bis zu 40 Prozent, am Gesamtbudget der Hochschulen aus.
Ein Fünftel davon stammt aus der gewerblichen Wirtschaft. Und vor allem um diese privaten Mittel geht es beim öffentlichen Streit um die Transparenzregel. Denn bei den wettbewerblich vergebenen öffentlichen Mitteln – etwa der Deutschen Forschungsgemeinschaft – herrscht ohnehin volle Transparenz. Nein, bei der Geheimnistuerei geht es in erster Linie um Auftragsforschung der gewerblichen Wirtschaft oder vielleicht in seltenen Fällen um Geheimforschung im Auftrag der öffentlichen Hand, z.B. des Militärs.
Im Übrigen fragt sich der interessierte Beobachter, warum ein derartiger Aufschrei über eine Transparenzregel erfolgt, die inzwischen eher zu einer Geheimschutzklausel abgeändert worden ist, wo es doch im geltenden „Freiheitsgesetz“ in § 71 Abs. 2 verbindlich heißt: „die Forschungsergebnisse (aus der Forschung mit Mitteln Dritter) sind in der Regel in absehbarer Zeit zu veröffentlichen“.
Hat man diesen Paragrafen eigentlich inzwischen vergessen oder haben ihn die Hochschulen ohne Beanstandung durch den Gesetzgeber schlicht außer Kraft gesetzt?
Offenbar wird überhaupt nicht mehr gesehen, dass die Forderung nach minimaler Detailregelung durch den Staat nur mit maximaler Transparenz der nach wie vor überwiegend staatlich finanzierten öffentlichen Einrichtung einhergehen kann. Autonomie und Transparenz sind sozusagen die beiden Seiten einer Medaille.
Gerade in einer Zeit, wo wegen rückläufiger staatlicher Grundfinanzierung die Drittmitteleinwerbung mehr und mehr zur Grundbedingung für Forschung überhaupt zu werden droht, wäre im Sinne der Garantie der Freiheit von Forschung und Lehre eine größtmögliche Transparenz darüber, wieviel für welche Forschungsziele von privaten oder auch staatlichen Auftraggebern bezahlt wird, umso gebotener. Denn für die Entwicklung der Forschung bedeutet dieser Trend der zunehmenden Drittmittelfinanzierung durch Private eine zunehmende Orientierung an der Verwertbarkeit der Forschung und nicht an ihrer Qualität und Objektivität. Die Geheimhaltung von Forschungsthemen und von Auftraggebern steht im Widerspruch zur Begründung der grundgesetzlichen Garantie und der staatlichen Gewährleistungspflicht für die Wissenschaftsfreiheit. Dass Transparenz der Forschung und die Unabhängigkeit von Auftraggebern sozusagen die Begründung für die Autonomie der Hochschule und für die Freiheitsgarantie für die Wissenschaft darstellen, scheint völlig aus dem Blick geraten zu sein.
3. These: Der Öffentlichkeit und sogar auch der Politik wird ein falsches Bild über die Stimmungslage an den Hochschulen vermittelt.
Man blättere nur einmal die Presseschau des Landtages seit der Vorlage eines Referentenentwurfs eines „Hochschulzukunftsgesetzes“ im November letzten Jahres durch. Keine der Regionalzeitungen hat es sich nehmen lassen, mit einem oder mehreren der in ihrem Verbreitungsgebiet ansässigen Rektor oder einer Rektorin zu sprechen, teilweise sogar mehrfach. Der Offene Brief der Hochschulratsvorsitzenden und die Drohungen der Wirtschaft mit einem Abzug von Forschungsmitteln aus NRW-Hochschulen wegen der Einfügung eines Transparenzparagrafens beherrschten tagelang die Schlagzeilen.
Würden wenigstens die Medien nicht nur mit den Hochschulführungen reden, sondern einmal in die Hochschulen hineingehen und mit Hochschulangehörigen aller Statusgruppen sprechen, würden sie ein ziemlich anderes Echo über das bestehende Hochschul-„Freiheits“-Gesetz und über das jeweilige Hochschulmanagement hören.
Offenbar werden z.B. die Studierenden immer erst gehört, wenn sie auf die Straße gehen und nicht, wenn sie ihre sachlichen Stellungnahmen abgeben (Vgl. hier oder etwa hier. Ausführliche Stellungnahmen etwa des DGB oder von ver.di sind bestenfalls eine Kurzmeldung wert. Auch Erklärungen von zahlreichen Professorinnen und Professoren oder von zivilgesellschaftlichen und hochschulnahen Organisationen werden politisch und medial kaum zur Kenntnis genommen.
Wer in die Hochschulen hineinhört, erfährt viel Unmut über die bestehenden Zustände. Darüber berichten die Rektoren natürlich in aller Regel nicht, richtet sich diese Kritik auch gegen sie selbst. Es ist deshalb auch nicht erstaunlich, dass diese Kritik von unten auch im Landtag nicht ankommt.
Der Hochschullehrerbund NRW hat vor einiger Zeit eine Umfrage unter Fachhochschulprofessor/innen gemacht:
Mit Einführung des Hochschulfreiheitsgesetzes in NRW wurde für knapp drei Viertel der Befragten die Selbstverwaltung der Hochschule durch den akademischen Senat entwertet.
Als Ursache wird von den meisten die Verlagerung der Entscheidungsbefugnisse auf die Leitungsorgane (69 %) gesehen. Das mit großen politischen Visionen eingeführte Gesetz hinterlässt bereits nach einigen Jahren erhebliche Kollateralschäden. So beklagen in der Umfrage [PDF] rund 40 % der Befragten, ihr Engagement in der Hochschule sei dadurch gebremst worden und 43 % der Professorinnen und Professoren fühlen sich sogar in ihrer wissenschaftlichen Freiheit nach Art. 5 Abs. 3 GG beeinträchtigt.
Über solche eher beängstigende Stimmungslagen erfährt man aus den Medien ziemlich wenig.
4. These: Die behaupteten Erfolge sind zweifelhaft
Die Vertreter der „unternehmerischen“, wettbewerbsgesteuerten Hochschule werden nicht müde ihre Erfolge zu bejubeln.
Ja, zugegebenermaßen haben die Hochschulen den Ansturm von Studienanfänger aufgrund der Abschaffung der Wehrpflicht und der doppelten Abiturientenjahrgänge einigermaßen konfliktfrei bewältigt. Das gilt aber nicht nur für die NRW-Hochschulen, deren „Entfesselung“ vom Staat am weitesten vorangetrieben wurde. Am Hochschul-„Freiheits“-Gesetz kann diese Leistung also nicht gelegen haben.
Dass knapp die Hälfte aller Studiengänge in Deutschland mit einer Zulassungsbeschränkung (numerus clausus) belegt ist und dass in NRW (mit 47%) sogar überdurchschnittlich viele Fächer zulassungsbeschränkt sind, darüber wird natürlich nicht so gerne gesprochen.
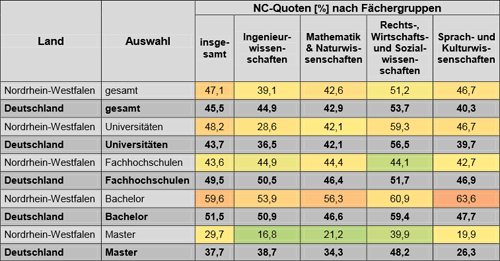
Quelle: che.de [PDF]
Doch dieser „äußere“ Numerus Clausus ist nur die eine Seite der Klagemauer: selbst wenn Studierende diese Mauer überwunden haben, wartet auf sie – gerade in einem Fach mit dem niedrigsten NC – bei den Ingenieurwissenschaften der „innere“ NC. 46 Prozent der Studierenden an den Universitäten in den Ingenieurwissenschaften brechen ihr Studium ab.
Wahrlich keine Erfolgsbilanz!
Ein Versagen auf ganzer Linie ist das Chaos [PDF] bei der Verteilung der knappen Studienplätze. Bis auf Medizin und einige wenige andere Fächer erfolgt die Hochschulzulassung dezentral durch die einzelnen Hochschulen. Seit Jahren haben sich Bund, Länder und die Hochschulen nicht auf ein Portal verständigen können, auf dem sich Studienberechtigte zentral und online für den Studiengang ihrer Wahl bewerben können. Das führt zu hunderttausenden Mehrfachbewerbungen und einem Einschreibewirrwarr, wodurch Studienplätze blockiert werden. Tausende der ohnehin knappen Studienplätze blieben unbesetzt. (Im Wintersemester 2011/12 waren es nach Angaben der KMK 13.300 Bachelor- und 6.000 Master-Studienplätze.) Ein trauriges Beispiel dafür, dass, wenn jede Hochschule für sich plant, nicht das beste Ergebnis herauskommt.
Auch in der Forschung werden von Rektoren und Hochschulratsvorsitzenden Erfolge der NRW-Hochschulen einfach so in den Raum gestellt, ohne dass man einen begründeten Nachweis für notwendig hält.
Weder das Förder-Ranking der DFG, also der Vergleich der Bewilligungsvolumen für die Forschung an den NRW-Hochschulen (Vgl. z.B. Tabelle 3-1 des Förder-Rankings 2009 der Deutschen Forschungsgemeinschaft [PDF]), noch die Exzellenzinitiative können als eindeutiger Beleg für die Behauptung einer generellen Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der NRW-Hochschulen dienen.
Die Ergebnisse der Exzellenzinitiative, bei der die RWTH Aachen ihren Exzellenzstatus behaupten konnte und die Universität Köln hinzugekommen ist und wonach drei Exzellenzcluster in NRW mehr eingeworben wurden, sind zwar erfreulich, sie bestätigten allerdings nur den allgemeinen Trend zur „Eliteförderung“. Dadurch wurden die bestehenden Unterschiede zwischen den Universitäten entscheidend verschärft und eine „symbolische Hierarchisierung“ der Hochschullandschaft vorangetrieben. (Siehe dazu Michael Hartmann, Die Exzellenzinitiative und die Hierarchisierung des deutschen Hochschulsystems)
Entgegen der allgemeinen Darstellung, wonach es nur „Gewinner“ gebe, gibt es unübersehbar auch klare Verlierer, bei einer gleichzeitigen Konzentration der Forschungsmittelvergabe auf einige wenige sog. „führende“ Hochschulen. (Allein von 2009 auf 2010 konnten die Drittmitteleinnahmen der RWTH noch einmal um 13,6 Prozent auf nun 258 Mio. Euro gesteigert werden.)
Wenn der Trend mit „symbolischen Gewinnern“ und einer umgekehrten „Verliererdynamik“ anhält, wird man im Ergebnis in peripheren Regionen eben vornehmlich auch periphere Universitäten finden (Klaus Dörre, Matthias Neis, Das Dilemma der unternehmerischen Hochschule, Hochschulen zwischen Wissensproduktion und Marktzwang, edition sigma, 2010, S. 148.)
Das Hochschul-„Freiheits“-Gesetz in NRW wird von der parlamentarischen Opposition gerne als das freiheitlichste Hochschulgesetz der Republik gerühmt, in dem der Wettbewerb zur besseren Qualität und zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen beigetragen habe. Das Gesetz ist nun fast acht Jahre in Kraft, wenn man die Verteilung der wettbewerblich eingeworbenen öffentlichen Forschungsfördermittel oder die Ergebnisse der Exzellenzinitiative (bei allen Vorbehalten) betrachtet, scheint die neue „Hochschulfreiheit“ in NRW gegenüber anderen Ländern die vollmundigen Erfolgsmeldungen über die heilsamen Wirkungen des geltenden Gesetzes nicht gerade zu stützen.
5. These: Hochschulzukunftsgesetz verbaut die Zukunft
Einige wenige Schritte nach vorn, sind dem Hochschulzukunftsgesetz nicht abzusprechen.
- Die Aufnahme eines Rahmenkodexes „Gute Arbeit“ ins Gesetz (§ 34 a) ist angesichts der Tatsache, dass an den Hochschulen über 80 Prozent der akademisch ausgebildeten Berufsanfänger mit bis zu drei Jahren Berufserfahrung befristet beschäftigt [PDF] sind, ein erster Schritt, der wenigstens einen institutionalisierten Diskussionsprozess in Gang bringen könnte. Es mag für die Hochschulbediensteten von Gewinn sein, dass die Hochschulen mit dieser Vorschrift angehalten werden, die prekären Beschäftigungsbedingungen an Hochschulen endlich als Problem anzugehen und die Debatte darüber zu institutionalisieren und auf Landesebene zu heben. Doch wie die Ergebnisse im Sinne besserer Arbeit an den Hochschulen aussehen werden, bleibt dabei völlig offen.
- Auch die Frauenförderung, die Aufnahme des sog. Diversity Managements in den Aufgabenkatalog der Hochschulen oder das Maßnahmepaket „Erfolgreich studieren“ sind begrüßenswert.
- Dass der Hochschulrat den Hochschulen ihren Rektor nicht aufzwingen kann, war schon verfassungsrechtlich geboten.
Bei den meisten – vor allem von Seiten der Rektoren, der Hochschulratsvorsitzenden und von Wirtschaftslobbyisten – besonders bekämpften Regelungen, sind im neuen Entwurf entweder Klarstellungen im Sinne der Kritiker vorgenommen worden oder die Regierung ist vor dem öffentlichen Aufstand zurückgewichen oder man hat einige Reizparagrafen gleich ganz gestrichen.
Aus einer Transparenzklausel wurde eine Geheimschutzklausel
Am deutlichsten zeigt sich das Einknicken der Landesregierung am Transparenzparagrafen.
Aus einer Transparenzklausel wurde geradezu eine Geheimschutzklausel.
Dort heißt es inzwischen:
§ 71a Fassung vom 27.03.2014
Transparenz bei der Forschung mit Mitteln Dritter
(1) Das Rektorat informiert die Öffentlichkeit in geeigneter Weise über abgeschlossene Forschungsvorhaben nach § 71 Absatz 1.
(2) Hinsichtlich des Schutzes personenbezogener Daten gelten die §§ 9 und 10 des Informationsfreiheitsgesetzes entsprechend.
(3) Eine Information nach Absatz 1 findet nicht statt, soweit durch die Übermittlung der Information ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis offenbart wird und dadurch die Gefahr des Eintritts eines wirtschaftlichen Schadens entsteht. Der oder dem Dritten ist vorher Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Entwicklungsvorhaben und Vorhaben zur Förderung des Wissenstransfers entsprechend.
Nimmt man noch die regierungsamtliche Begründung zu diesem Paragrafen hinzu, so liegt es künftig nahezu ausschließlich am Auftraggeber, ob informiert werden darf.
In der Begründung heißt es:
„Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse im Sinne dieser nicht ausnahmslos eng auszulegenden Regelung sind im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Unternehmens stehende Tatsachen, Umstände oder Vorgänge, die nur einem begrenzten Personenkreis zugänglich sind, für Außenstehende aber wissenswert sind, die nach dem bekundeten Willen des Betriebs- oder Geschäftsinhabers geheim zu halten sind und deren Kenntnis durch Außenstehende dem Geheimnisschutzträger zu einem Nachteil gereichen kann. Betriebsgeheimnisse umfassen im Wesentlichen technisches Wissen im weitesten Sinne; Geschäftsgeheimnisse betreffen vornehmlich kaufmännisches Wissen. Hierzu können auch Forschungs- und Entwicklungsprojekte gehören.
Nicht erforderlich ist, dass durch die das Geheimnis bildenden Tatsachen, Umstände oder Vorgänge die wirtschaftlichen Verhältnisse eines Betriebs maßgeblich bestimmt werden können. Es reicht vielmehr hin, dass die Offenbarung für den Geheimschutzträger nachteilig sein kann…
Der Nachweis, dass durch die Information über das drittmittelgeförderte Forschungsvorhaben ein wirtschaftlicher Schaden entstehen würde, ist desto schwieriger zu führen, desto weniger das Forschungsthema anwendungsbezogen und unmittelbar zu innovationsreifen Produkten führen dürfte.
Angesichts dessen entspricht es den Eigengesetzlichkeiten des Forschungsbereichs, dass nach Satz 1 eine Informationspflicht bei Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen dann nicht besteht, wenn die Gefahr – also die belastbare Wahrscheinlichkeit – des Eintritts eines Schadens entsteht. Eine derartige Gefahr kann beispielsweise bejaht werden, wenn bei Information die Gefahr der Industriespionage steigt oder wenn im Lichte einer unternehmerischen Gesamtstrategie die durch die Drittmittelforschung vorangetriebene Innovationsreife eines Produkts erst später marktwirksam werden soll und diese Marktstrategie durch eine Information vereitelt würde.“ (S. 302f.)
Man muss wohl lange nach einer Fallgestaltung suchen, wo der Drittmittelgeber nicht seinen „Willen bekunden“ kann, dass eine Information über „abgeschlossene Forschungsvorhaben“ für ihn „zu einem Nachteil gereichen kann“.
Die Einschränkung, dass diese Geheimhaltungsklausel nicht gilt, wenn „die Allgemeinheit ein überwiegendes Interesse an der Gewährung der Information hat und der wahrscheinlich eintretende Schaden nur geringfügig wäre“ (§ 71 a Abs. 3 Satz 2 HZG NRW) ist nicht mehr als weiße Salbe. Wie sollte „die Allgemeinheit“ etwas über diese Forschungsaufträge erfahren und wer sollte deren überwiegendes Interesse an der „Gewährung“ (!) der Information feststellen und wer, wenn nicht der Drittmittelgeber, kann etwas über den möglichen Schadensumfang einer Veröffentlichung aussagen?
Aber selbst diese Ausnahmeregelung geht offenbar den Geheimnishütern noch zu weit, wie man der Presse entnehmen konnte. Angesichts dieser Situation wäre es am vernünftigsten auf diese (In-)Transparenzregel ganz zu verzichten und mit der Bestimmung des geltenden Hochschulgesetzes wieder ernst zu machen, wonach die Forschungsergebnisse ganz generell in der Regel zu veröffentlichen sind. Dann wäre die Veröffentlichung wenigstens die Regel und nicht die Ausnahme.
Kein Leitbildwechsel
Ziel einer Gesetzesnovelle hätte sein müssen, unter dem Dach der grundgesetzlichen Garantie der Freiheit von Forschung und Lehre, die subjektive, individuelle Wissenschaftsfreiheit der Hochschulangehörigen (auch der Studierenden) und das daraus abgeleitete Recht der Selbstverwaltung der Hochschule mit der Gesamtverantwortung des demokratischen Staates für das Hochschulwesen zu einer neuen Balance zu bringen.
Dieser Anspruch wird zwar in der Begründung für ein neues Hochschulzukunftsgesetz formuliert, bei dessen Konkretisierung bleibt der Gesetzentwurf allerdings auf halbem Wege stecken.
Das Leitbild der wettbewerbsgesteuerten „unternehmerischen Hochschule“, das dem derzeit geltenden Landeshochschulgesetz zugrunde liegt, hat noch nie zu den Hochschulen gepasst.
Die funktionelle Privatisierung der Hochschulen als „unternehmerische Hochschulen“ mit einer Aufsichtsratsstruktur, die einer privatrechtlichen Aktiengesellschaft nachgebildet ist, wird im neuen Gesetz beibehalten. Im Gegenteil, die Entscheidungsbefugnisse der niemanden rechenschaftspflichtigen Hochschulräte werden sogar in finanziellen und wirtschaftlichen Belangen (§ 16 Abs. 4 Gesetzentwurf v. 23.03.2014)) noch erweitert.
Das sog. Hochschul-„Freiheits“-Gesetz ist nun schon seit 8 Jahren in Kraft, wenn es ein neues Gesetz gäbe, hätte dies sicherlich wieder viele Jahre Gültigkeit. Für ein derart halbherziges und inzwischen zahnloses „Zukunftsgesetz“ lohnt sich der politische Aufwand nicht. Da sollte man lieber zuwarten, bis der Unmut an der Basis der Hochschulen weiter zunimmt, um den nötigen politischen Druck von unten für eine wirkliche Reform aufbauen zu können.
Ohne demokratischen Gegendruck aus der Gesellschaft und vor allem auch aus den Hochschulen selbst gegen die Lobby der „unternehmerischen Hochschule“ macht eine Novelle keinen Sinn.
[«*] Anmerkung: Dieser Text basiert auf meinen Vorbereitungsmaterialen für eine Podiumsdiskussion beim Hochschullehrerbund NRW am 12.04.2014 in Köln.
Hauptadresse: http://www.nachdenkseiten.de/
Artikel-Adresse: http://www.nachdenkseiten.de/?p=21392