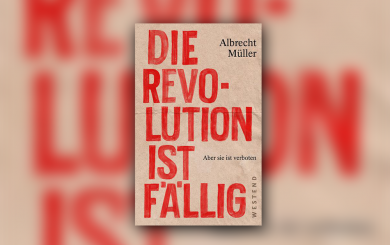Jüngere Menschen empfinden das, was heute um uns herum beim Komplex Ukraine, Russland und der Westen vorgeht, möglicherweise als nicht so schlimm wie Menschen aus meiner Generation. Es wird untereinander und in den Medien vom Krieg geredet und geschrieben, als handle es sich um den nächsten Auto-Blechschaden. Über diese Entwicklung hatte ich in meinem Buch „Die Revolution ist fällig“ ein eigenes Kapitel geschrieben. Jetzt habe ich den Westend Verlag gebeten, dieses Kapitel II.8. auf den NachDenkSeiten veröffentlichen zu dürfen. Der Verlag gewährt treuen NachDenkSeiten-Leserinnen und -Lesern außerdem einen Nachlass. Sie erhalten das Buch versandkostenfrei und mit 20 Prozent Rabatt, wenn Sie bei Ihrer Bestellung den folgenden Rabatt-Code angeben: revolution-nds-20. Albrecht Müller.
Kapitel II.8.:
8. Kriege sind der Ernstfall. Ein wirklicher Rückfall
Wir hatten einmal einen Bundespräsidenten, der zu Beginn des historischen und gelungenen Versuchs, die Konfrontation in Europa durch eine neue Friedenspolitik abzulösen, anmerkte, der Frieden und nicht der Krieg sei der Ernstfall. Was der neugewählte Bundespräsident Gustav Heinemann dazu bei seiner Antrittsrede 1969 sagte, macht deutlich, wie sehr unsere Lage und der Geist, der die Außen- und Sicherheitspolitik bestimmt, in den letzten Jahrzehnten zum Schlechteren verändert worden sind. Heinemann sagte damals:
»Ich sehe als erstes die Verpflichtung, dem Frieden zu dienen. Nicht der Krieg ist der Ernstfall, in dem der Mann sich zu bewähren habe, wie meine Generation in der kaiserlichen Zeit auf den Schulbänken lernte, sondern der Frieden ist der Ernstfall, in dem wir alle uns zu bewähren haben. Hinter dem Frieden gibt es keine Existenz mehr.
24 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg stehen wir immer noch vor der Aufgabe, uns auch mit den östlichen Nachbarn zu verständigen. Das allseitige Gespräch über einen gesicherten Frieden in ganz Europa ist fällig und muss kommen. Mit dem deutschen Volk, dem Deutschen Bundestag und der Bundesregierung weiß ich mich einig in dem Willen zum Frieden. Ich appelliere an die Verantwortung in den Blöcken und an die Mächte, ihre Zuversicht auf Sicherheit nicht im Wettlauf der Rüstungen, sondern in der Begegnung zu gemeinsamer Abrüstung und Rüstungsbegrenzung zu suchen. [Beifall] Abrüstung erfordert Vertrauen. Vertrauen kann nicht befohlen werden; und doch ist auch richtig, daß Vertrauen nur der erwirbt, der Vertrauen zu schenken bereit ist.«
Die beiden letzten Sätze könnten heute wieder so und genauso treffend und einschlägig formuliert werden. Denn wir sind genau dahin zurückgefallen, wo wir in den 1950er- und 60er-Jahren waren: Konfrontation, Misstrauen, sogar die Neigung, Kriege zu führen, also nicht nur abzuschrecken und zu drohen. Das ist ein wirklicher Rückschritt, faktisch und konzeptionell.
Es hatte Ende des Zweiten Weltkrieges noch hoffnungsvoll begonnen. »Nie wieder Krieg« war damals die Parole. Dann aber wurde der westliche Teil des geteilten Deutschlands in die NATO integriert und Westdeutschland wurde aufgerüstet – Wiederbewaffnung nannte man das damals – und es begann der unselige Kalte Krieg bis hin zum Mauerbau 1961.
Dieses Ereignis führte zu einer Denkpause. Bei den konservativen Parteien, also bei CDU und CSU, dauerte es. Sie waren trotz des Offenbarungseids der damaligen Sicherheitspolitik, die mit dem Mauerbau sichtbar wurde, zunächst nicht zu einer Revision ihrer Konfrontations- und Kalten-Kriegs-Position bereit. Aber der Offenbarungseid der bisherigen »Kalten-Kriegs-Politik« erweiterte den politischen Spielraum jener politischen Kräfte und Personen, die schon in den 1950er-Jahren über eine andere Konzeption der Außen- und Sicherheitspolitik nachdachten. Das waren vor allem Sozialdemokraten unterstützt von einigen Personen in Verbänden, Gewerkschaften und Kirchen. Und ab der Großen Koalition, die von 1966 bis 1969 Deutschland regierte, konnten die Anführer der neuen Politik, also Willy Brandt, Gustav Heinemann, Egon Bahr, Herbert Wehner, Helmut Schmidt und andere Sozialdemokraten und auch einige Freidemokraten an die Verwirklichung einer anderen Außen- und Sicherheitspolitik denken.
Nachzutragen bleibt: Für ein friedliches Zusammenleben plädierten schon in den 1950er-Jahren auch die meisten Kommunisten in West- und Ostdeutschland.
Heinemann wurde im März 1969 zum Bundespräsidenten gewählt – von einer Koalition aus SPD- und FDP-Abgeordneten in der Bundesversammlung. Diese Koalition schaffte dann auch den politischen Wechsel bei der Bundestagswahl im September 1969. Der neue Bundeskanzler Brandt sprach in seiner ersten Regierungserklärung am 28. Oktober den entscheidenden Satz, der sowohl einen Richtungswechsel bei der Außenpolitik als auch einen zugrundeliegenden konzeptionellen Wechsel der Politik im Verhältnis zu anderen Völkern darstellte. »Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein« war einer der Kernsätze. Das lag voll auf der Linie der zitierten Äußerung des Bundespräsidenten. Dann wurden – beginnend schon im folgenden Jahr – Verträge mit den östlichen Nachbarn abgeschlossen – mit Moskau, mit Warschau, mit Prag. Gewaltverzichtsversprechen waren der Kern dieser Verträge, zudem Zusammenarbeit sowie wirtschaftlicher und sozialer und kultureller Austausch.
1975 folgte die KSZE, damals traf man sich in Helsinki. Die Konferenz enthält schon in der Bezeichnung die Wegmarken der eingeschlagenen Politik: Sicherheit und Zusammenarbeit, man könnte auch sagen Sicherheit durch Zusammenarbeit.
Die neue Ostpolitik – die viele Namen hatte: Vertragspolitik, Friedenspolitik, Verständigungspolitik, Versöhnungspolitik – gipfelte 1989 im Fall der Mauer und 1990 im Vertrag über die deutsche Einheit und in der Charta von Paris. Man verabredete damals, gemeinsam an der Sicherheit zu arbeiten, also nicht gegeneinander zu rüsten, sondern abzurüsten und sich zu verständigen.
Der damalige deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl und der Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) Michail Gorbatschow haben sich ausgesprochen gut verstanden.
Auch das am 20. Dezember 1990 beschlossene Berliner Grundsatzprogramm der SPD zeigt, wie weit wir damals waren. Ich zitiere aus dem Kapitel »III. Frieden in gemeinsamer Sicherheit«:
»Aufgabe Frieden
Die Menschheit kann nur noch gemeinsam überleben oder gemeinsam untergehen. […]
Friedenspolitik muss die Vorherrschaft militärischer, bürokratischer und rüstungswirtschaftlicher Interessen brechen und Rüstungsproduktion in die Produktion ziviler Güter überführen. […]
Gemeinsame Sicherheit
»Ost und West« haben den Versuch, Sicherheit gegeneinander zu errüsten, mit immer mehr Unsicherheit für alle bezahlt. […]
Unser Ziel ist es, die Militärbündnisse durch eine europäische Friedensordnung abzulösen […]
Dies eröffnet auch die Perspektive für das Ende der Stationierung amerikanischer und sowjetischer Streitkräfte außerhalb ihrer Territorien in Europa […]
Die Bundeswehr hat ihren Platz im Konzept gemeinsamer Sicherheit. Sie hat ausschließlich der Landesverteidigung zu dienen. Ihr Auftrag ist Kriegsverhütung durch Verteidigungsfähigkeit bei struktureller Angriffsunfähigkeit. Die Struktur der Bundeswehr muss den Abrüstungsprozess unterstützen und fördern.«
Man könnte die Forderungen und Vorschläge des Berliner Programms der SPD von 1990 direkt auf heute übertragen. Sie wären wichtige und richtige Wegmarken einer neuen Friedenspolitik. Aber die Welt wurde inzwischen völlig verändert und auch die SPD hat sich angepasst: Die Idee von der gemeinsamen Sicherheit gilt noch zwischen den westlichen Partnern, aber sie gilt nicht mehr im Verhältnis zu Russland und auch nicht im Verhältnis zu China.
Im Verhältnis zu diesen und einigen anderen »Feindstaaten« ist man zurückgekehrt zu den Rezepten des Kalten Krieges der 1950er-Jahre. Bei der amtierenden CDU-Vorsitzenden und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer kann man das nachhören und nachlesen: Sie spricht von »Abschreckung« und von der »Politik der Stärke«. Das waren die Formeln und Konzepte, mit denen wir uns als Schüler und Studenten Ende der 1950er-Jahre in Auseinandersetzungen mit der Jungen Union und der Schüler Union herumgeschlagen haben. Ich muss gestehen, dass ich wirklich dachte, diese Zeiten seien überwunden. Eigentlich dachte ich, wir seien schon viel weiter. Stattdessen haben wir es mit Restauration und Rückschritt zu tun.
Der faktische Rückschritt:
Wir rüsten nicht ab, sondern auf. Hier bei uns in der NATO, in Russland und in vielen anderen Ländern. Von Friedensdividende, wie man im Anschluss an die Verständigung des Jahres 1990 meinte, keine Spur.
Der INF-Vertrag zum Verzicht auf landgestützte Mittelstreckensysteme wurde 2018 von den USA gekündigt. Russland zieht nach. Wiederaufrüstung statt Abrüstung.
Die NATO wurde nicht durch eine europäische Friedensordnung abgelöst, sie wurde bis an die Grenze Russlands ausgedehnt.
Das Militärbündnis NATO dient nicht der Kriegsverhütung. Es führte und führt Kriege – gegen Restjugoslawien, im Irak, in Syrien, in Afghanistan, in Afrika – und richtet sich jetzt sogar auf eine Konfrontation mit China ein. Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, sagte beispielsweise: »China investiert stark in Nuklearwaffen und Langstreckenraketen, die Europa erreichen können. Die Nato-Verbündeten müssen sich gemeinsam dieser Herausforderung stellen.« Ist das die notwendige friedenspolitische Linie? Ist das vernünftige Sicherheitspolitik?
Das konzeptionelle Versprechen, die Bundeswehr diene ausschließlich der Landesverteidigung, ist gebrochen worden. Auch die Bundeswehr ist in Interventionskriege des Westens verstrickt. Und wenn die Rechtfertigung verschiedener Art nicht reicht, dann erfindet man blumige Begründungen wie jene von Peter Struck, des ehemaligen Verteidigungsministers, unsere Sicherheit werde auch am Hindukusch verteidigt.
Deutschland ist nach wie vor eine wichtige militärische Basis anderer Staaten, vor allem der USA. Wir sind das Aufmarschgebiet für Manöver, die bis an die russische Grenze reichen. Wir sind das Übungsgebiet für die Lufteinsätze von NATO-Flugzeugen. Während ich diesen Text schreibe, üben über meinem Kopf alliierte Verbände den Luftkampf. Nicht weit von hier, 80 Kilometer im Nordwesten, in Ramstein, ist eine der großen militärischen Basen der USA. Von dort wird auch der Drohnenkrieg vermittelnd gesteuert. Nicht weit davon entfernt, in Landstuhl, wird das zweitgrößte Militärkrankenhaus der USA gebaut. Und wir Deutschen zahlen einen Teil der Kosten. 100 Kilometer östlich von hier befindet sich in Stuttgart das Hauptquartier der USA für Militäreinsätze in Europa, für Afrika und den asiatischen Teil Russlands. Weiter im Norden meines Bundeslandes Rheinland-Pfalz sind US-amerikanische Atombomben stationiert und werden modernisiert. Bundeswehrflugzeuge sollen sie im Konfliktfall hinter die feindlichen Linien transportieren.
Von deutschen Politikern und von vielen deutschen Medien wird der Konflikt mit Russland angeheizt. Systematisch wird das Feindbild aufgebaut, insbesondere das Feindbild Putin.
Wir alle bezahlen für den Rückschritt: Die erwähnte Friedensdividende fällt aus, auch deutsche Soldaten sterben wieder und, was mit das Schlimmste ist: Mit den vom Westen geführten Kriegen werden die Wohnungen und die Arbeitsstätten von Millionen von Menschen zerstört. Sie werden heimatlos. Sie versuchen ihr Glück woanders, soweit sie überlebt haben. Die Zahl der sogenannten gescheiterten Staaten und die Zahl der Flüchtlinge wächst. Kriege sind die Hauptursache dafür, dass Menschen ihre Heimat verlassen und fliehen und Hilfe und Heimat woanders suchen.
Das Bedrohliche: Die Kriegsgefahr wächst auch hierzulande. Deutschland ist zentral gefährdet, wenn es zum Konflikt zwischen Ost und West, zwischen Russland und dem Westen kommen sollte. Und die Gefahr eines Krieges ist ganz und gar nicht auszuschließen. Nur Ignoranten und Träumer tun das.
Schon einmal bestand die Gefahr einer kriegerischen und auch atomaren Auseinandersetzung. 1983 hat der russische Oberstleutnant Stanislaw Petrow die Knöpfe nicht gedrückt, obwohl es angezeigt und er dazu verpflichtet gewesen wäre.
Die Kriegsgefahr ist größer geworden. Das will ich an zehn Punkten, an zehn Risiken für den Frieden, sichtbar machen:
Werbung für den militärischen Einsatz, Kriegstreiberei ist wieder hoffähig geworden. Kriege zu führen wird als selbstverständlicher Teil der Politik betrachtet.
Es gibt unter den Menschen geringeren Widerstand gegen Kriege. Das hat viel damit zu tun, dass die meisten heute lebenden Menschen keine unmittelbare Kriegserfahrung mehr haben, nicht mehr haben können. Die Älteren unter ihnen haben vermutlich Verwandte und Freunde verloren im letzten Krieg oder sie haben Kriegseinsätze unmittelbar erlebt. Ich bin in einem Dorf aufgewachsen, dessen Bahnhof ein Knotenpunkt auf einer Strecke zu einer V2-Produktion war. Wir waren ständig Angriffen von Jagdbombern ausgesetzt. Es gab Tote. Das prägt. Die Kriegserfahrung unserer heute Sechsjährigen ist eine ganz andere: eine elektronische beim Spiel, eine spannende, oft eine siegreiche. Das prägt auch.
Kriege werden tatsächlich geführt. Die Scheu ist abhandengekommen. Bei Journalisten und Journalistinnen, bei Politikern und Politikerinnen und auch bei Militärs: »Die USA sind bereit, gegen Russland in Europa zu kämpfen und es zu besiegen«, erklärte der Supreme Allied Commander Europe (SACEUR), US-General Philip Breedlove, in einer Anhörung des US-Repräsentantenhauses im Februar 2016. Das hat in der anerkannten Öffentlichkeit in Deutschland kein Echo, auch keinen Protest ausgelöst.
Die Regime Change-Absichten der USA sind höchst gefährlich, gerade wenn sie wie im Falle der Ukraine ein Land in der Nähe Russlands betreffen oder Russland selbst. Diese Absicht ist erkennbar, sie kann konkreter werden und dann kann sie noch gefährlicher werden.
Überall wird an neuen Feindbildern gestrickt. Es wird personalisiert. Putin ist an allem schuld, in Syrien Assad.
Und das Volk ist müde geworden. Das ist verständlich. Der Betrug an uns und unseren Erwartungen und Leistungen zur Beendigung der Konflikte in Europa hat ja wohl bei der Mehrheit der Menschen den Eindruck hinterlassen, dass man eh nichts machen kann, dass die Politik von den Oberen bestimmt wird, dass die Rüstungswirtschaft Einfluss auf politische Entscheidungen hat und damit auch auf Kriege.
Die USA sind weit weg. Die zitierte Äußerung des Generals der USA lautet ja nicht zufällig: »Die USA sind bereit, gegen Russland in Europa zu kämpfen und es zu besiegen.« Wenn der General angedeutet hätte, dass dieser Krieg auch in den USA selbst geführt werden könnte, wäre er im Ausschuss des Repräsentantenhauses vermutlich nicht freundlich aufgenommen worden.
Im heutigen Ost-West-Konflikt gibt es viele verschiedene Akteure und es gibt viele Gelegenheiten und Möglichkeiten, an denen sich Spannungen entzünden können. Die baltischen Staaten, die Ukraine, die Balkanstaaten, die Rüstungswirtschaft bei uns, in den USA, in Großbritannien, irgendwelche rechts konservativ denkenden Funktionäre – sie alle können die Ursache von kleinen und größer werdenden Konflikten werden.
Es gibt russische Minderheiten in mehreren möglichen Konfliktregionen.
Es ist nicht auszuschließen, sondern eher wahrscheinlich, dass sich auf mittlere Sicht innerhalb möglicher Kriegsparteien kriegslüsterne oder auch nur kriegsbereite Personen und Gruppen durchsetzen. Das kann in den USA passieren. Das kann in Dänemark, in Polen, in den baltischen Staaten oder sonst wo passieren. Und auch in Russland. So wie wir erfolgreich darauf setzen konnten, dass die Strategie des »Wandel durch Annäherung« dazu führen könnte und wird, dass sich in Russland und im Warschauer Pakt Kräfte durchsetzen, die Konflikte friedlich lösen wollen und auf gemeinsame Sicherheit in Europa setzen, so kann umgekehrt die neue Konfrontation zu inneren Veränderungen in Russland führen, die uns dem heißen Konflikt näher bringen.
Mit der Beschreibung dieser zehn Risiken für den Frieden will ich nicht Angst machen. Ich will ein realistisches Bild von der veränderten Situation zeichnen. Es gibt so viele verschiedene Spieler in den heutigen Auseinandersetzungen und die Wirklichkeit der Welt ist so stark von militärischen Aktionen geprägt, dass es ganz und gar nicht abwegig ist, die Wahrscheinlichkeit eines großen Krieges für hoch zu halten.
Der konzeptionelle Rückschritt
Die zuvor beschriebenen Elemente der eingetretenen Restauration in der Friedenspolitik sind ja schon beunruhigend genug. Hinzu kommt die konzeptionelle Veränderung, die seit 1990 Platz gegriffen hat. Es herrscht ein anderer, ein reaktionärer Geist beim Umgang mit anderen Völkern. Das ist nicht neu und es ist ganz und gar nicht die Ausnahme. Ausnahmen waren Personen wie Willy Brandt, Gustav Heinemann, Egon Bahr, Olof Palme und andere ähnlich denkende Menschen.
Nehmen Sie die praktische Politik in den Zeiten des Kalten Krieges. Da dachte man so, wie konservative, reaktionäre, nationalistisch gesonnene Personen denken: Andere Völker sind Konkurrenten, sie wollen einem ans Leder, sie verstehen vor allem die Sprache der Macht und der Drohung. In den Zeiten des Kalten Krieges hießen die Parolen wie schon erwähnt: Abschreckung und Politik der Stärke. Als Brandt für die Außen- und Sicherheitspolitik verantwortlich war, wurde dieser Geist abgelöst durch den Geist der Partnerschaft, des Sich-Vertragens, des Versöhnens, der Vertrauensbildung und auch der Vorleistung, wenn das der Vertrauensbildung und Verständigung diente.
Ja, wenn man das Vertrauen der Völker und der politischen Führungen in den Staaten, mit denen man bisher im Kalten Krieg lebte, gewinnen wollte, dann musste man notfalls auch Vorleistungen erbringen. Das hieß konkret in der damaligen Situation: Die deutsche politische Führung musste, um mit Polen und damit mit dem gesamten Ostblock ins Gespräch zu kommen, die am Ende des Zweiten Weltkriegs gezogene Ostgrenze, die Oder-Neiße-Grenze, anerkennen. Das war in Deutschland ungemein schwer durchzusetzen, weil damit Regionen, die die Heimat von Flüchtlingen und Vertriebenen waren und die in den Augen vieler Deutscher als Deutsch galten, aufgegeben wurden.
Aber den Verantwortlichen und den einsichtigen und zukunftsgewandten Personen in der deutschen Öffentlichkeit war klar, dass die sogenannten Ostgebiete nicht durch die Bundesregierung, die die Oder-Neiße-Grenze anerkannte, verschenkt wurden, sondern de facto von Hitler-Deutschland verspielt worden waren. Das war schwer zu erklären und dennoch hat der damalige Bundeskanzler Brandt trotz dieser Hypothek bei der nächsten Bundestagswahl eine überzeugende Mehrheit für seine Politik gewonnen. Die Friedenspolitik und die Versöhnungspolitik waren also nicht nur sachlich richtig, sie fanden auch die Zustimmung der Mehrheit unseres Volkes. Allerdings nach einem harten Kampf.
Entscheidend im Kontext dieser Erörterung ist der andere Geist, der damals die Außenpolitik und die Sicherheitspolitik bestimmte: Andere Völker wurden nicht als Konkurrenten oder gar Gegner gesehen, sondern als Partner. Außen- und Sicherheitspolitik beschränkte sich nicht auf ein »do ut des« –: ›ich gebe dir dann etwas, wenn du mir etwas gibst‹. Dieser Geist ist der klassische Geist einer konservativen und reaktionären sowie auf den kurzsichtigen Vorteil bedachten Außenpolitik.
Die damalige Regierung setzte auf Partnerschaft und Freundschaft statt auf Konfrontation und Feindseligkeit.
Wo ist dieser Geist geblieben? Er wäre dringend nötig, wenn wir heute die schon wieder gewachsene Konfrontation zu Russland und die neu konzipierte Konfrontation mit China umkehren wollten. Aber dieser Geist ist weit und breit nicht aufzuspüren – weder bei der amtierenden Bundesregierung unter der Kanzlerin Merkel noch bei der Mehrheit der SPD-Fraktion oder den Grünen. Restauration, Reaktion, wachsender Nationalismus.
Im Mai 2020 betont Horst Teltschik, der frühere außenpolitische Berater von Kohl, in einem Interview: »Politik muss immer ein Dual Base sein. Nach dem Motto: Wenn du Schritte in die richtige Richtung machst, bin auch ich bereit, Schritte zu machen.«
Wenn Brandt und seine Mitstreiter 1969 diesem sicherheitspolitischen Konzept gefolgt wären, dann wäre die damalige entspannungspolitische Offensive mit aller Wahrscheinlichkeit stecken geblieben. An dieser Äußerung von Teltschik bestätigt sich auch mein sonstiger Eindruck, dass trotz aller Verdienste dieses Mitarbeiters von Kohl und von Bundeskanzler Kohl selbst in der Endphase der Entspannungspolitik dieser jetzt bei Teltschik erkennbare Geist den Einstieg und den eigentlichen Fortschritt der damaligen Friedenspolitik nicht gebracht hätte. Auch an diesem Zitat wird deutlich, dass Helmut Kohl, der Einheitskanzler, wie es heißt, geerntet hat, was andere vor ihm gesät haben. Das – ich wiederhole mich – soll die Anerkennung für seine Leistung nicht mindern. Schließlich gilt für heute: Wenn wir wenigstens noch etwas vom sicherheitspolitischen Verständnis des Helmut Kohl hätten, dann wären wir reich gesegnet. Aber heute herrscht gerade in seiner Partei von Angela Merkel über Norbert Röttgen und Ursula von der Leyen bis zu Annegret Kramp-Karrenbauer ein anderer Geist.