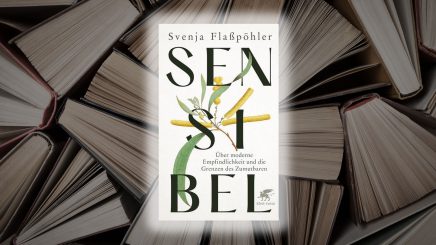Mehr denn je ist unsere Gesellschaft damit beschäftigt, das Limit des Zumutbaren neu zu justieren: Welche Begriffe darf man heute noch verwenden und welche nicht? Müssen alte Klassiker sprachlich „gesäubert“ werden, damit sich niemand verletzt fühlt? Ab wann ist eine Berührung eine Belästigung? Diese und ähnliche Fragen spalten die Gesellschaft zunehmend und haben bereits zu einem Verlust an demokratischer Debattenkultur geführt: Viele Menschen haben inzwischen Angst davor, ihre Meinung zu äußern und sind sehr vorsichtig geworden. Die promovierte Philosophin und Chefredakteurin des Philosophie Magazins, Svenja Flaßpöhler, beschäftigt sich deshalb in ihrem neuen Buch („Sensibel. Über moderne Empfindlichkeit und die Grenzen des Zumutbaren“) mit der Dialektik der Sensibilität. Sie versucht einen Weg zu finden, wie man zu einem angemessenen Verhältnis von gesellschaftlicher Sensibilität und individueller Widerstandskraft im Sinne von Robustheit finden kann. Unser Autor Udo Brandes hat es bereits für die NachDenkSeiten gelesen und stellt es vor.
Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.
Podcast: Play in new window | Download
Mit Bezug auf Norbert Elias’ zweibändiges Werk „Der Prozess der Zivilisation“ macht Flaßpöhler sehr schön anschaulich deutlich, wie mühselig für uns Menschen das Zivilisiert-Sein eigentlich sein muss, auch wenn es uns nicht bewusst ist. Dafür schildert sie einen Ritter, der im 11. Jahrhundert lebte, und vergleicht dessen Lebensweise mit der eines modernen, verheirateten Akademikers mit seiner Familie in einer Großstadt. Hier ein kleiner Ausschnitt. Den fiktiven Ritter nennt sie „Johan“:
„Johan plündert Kirchen, vergewaltigt, quält Witwen und Waisen, verstümmelt seine Opfer. Einmal hat er in einem Kloster hundertfünfzig Männern und Frauen die Hände abgeschnitten und die Augen ausgequetscht. Christiane (seine Frau; UB) ist übrigens nicht zimperlicher als ihr Mann, im Gegenteil. Niederstehenden Frauen lässt sie die Brüste abschneiden oder die Nägel ausreißen. Die eigene Gewaltbereitschaft ist für Johan lebenswichtig und lustbesetzt. Herrscht gerade kein Krieg, kämpft Johan in Turnieren, die nicht weniger brutal verlaufen. Wer die ‚Entzückung‘ des Tötens nicht kennt, stirbt schnell“ (S. 33).
Und jetzt ein kleiner Ausschnitt aus dem Kontrastprogramm, dem modernen Akademikerhaushalt von heute. Der Protagonist heißt hier Jan:
„Jan wurde, als er selbst klein war, kein einziges Mal geschlagen. Nie käme es ihm in den Sinn, Hand anzulegen, auch bei seinen Kindern setzt er selbstverständlich auf die Kraft von Zuwendung und Diskurs. Er nimmt sich Zeit für sie, schmust und spricht ausführlich mit ihnen, fühlt sich ein in ihre Welt. Wenn er seiner sechsjährigen Tochter ‚Pipi Langstrumpf‘ vorliest (die Ausgabe stammt noch aus seiner eigenen Kindheit), lässt er das ‚N-Wort‘ weg und sagt stattdessen ‚Südseekönig’, damit sein Kind die Bezeichnung, mit der schwarze Menschen jahrhundertelang herabgewürdigt wurden und immer noch werden, gar nicht erst in ihren Wortschatz übernimmt. (…) Er kocht gern, und aus ethischen Gründen, nur vegetarisch. Tiere seien leidensfähige Wesen, die einen tiefen, drängenden Lebenswillen in sich trügen: Welchen anderen Schluss als den Verzicht lasse dieser Tatbestand zu, so Jan, wenn Freunde ihn auf seinen Vegetarismus ansprechen“ (S. 34).
Feinfühligkeit bedeutet immer auch Zwang – gegen das eigene Selbst
Beide Porträts, die im Buch deutlich länger sind, machen eines sehr schön anschaulich: Der moderne zivilisierte Mensch muss im Laufe seiner Sozialisation ein enormes Ausmaß an Affektregulierung lernen und verinnerlichen. Mit anderen Worten: Sensibilität hat einen Preis: Den verinnerlichten Zwang, die eigenen Affekte zu unterdrücken. Flaßpöhler formuliert das so:
„An die Stelle der äußeren Gewalt tritt im Zuge der Zivilisationsgeschichte in immer stärkerem Maße eine innere: das peinigende, einzwängende Gewissen“ (S.104).
Aber funktioniert das Gewissen reibungslos? Können wir ohne Probleme unsere Affekte regulieren?
Freuds Triebtheorie oder warum man das Böse nicht ausrotten kann
Ein wichtiger – und wie ich finde überzeugender – Baustein in Flaßpöhlers Argumentation ist die Freudsche Triebtheorie. Dazu zitiert sie aus Freuds Schrift „Zeitgemäßes über Krieg und Tod“, die er unter dem Eindruck des 1. Weltkrieges und der zu Beginn des Krieges zu beobachtenden Kriegsbegeisterung geschrieben hat. Freud fragt darin, warum der zivilisatorische Fortschritt einen solchen Krieg zulasse, und kommt zu dem Ergebnis, dass die Ausrottung des Bösen eine Illusion ist. Flaßpöhler schreibt dazu:
„Das verheerende Problem liegt nun für Freud nicht in der negativen Bewertung unserer ‚Triebveranlagung‘ als solcher – wie sollte sonst Kultur entstehen? – sondern darin, dass die im modernen Menschen noch wohnende ‚Gefühlsambivalenz‘ nicht gesehen und anerkannt wird. ‚Starkes Lieben und starkes Hassen‘, so zeige sich in seiner Arbeit, seien in der Regel in ein und demselben Menschen vereint, und alles hänge davon ab, ob und in welcher Weise die verpönte Seite verarbeitet, die Triebveranlagung des Menschen gebunden, übersetzt, aufgefangen wird. Um so fataler ist es aus Freuds Sicht, dass die ‚Kulturgesellschaft (…) die gute Handlung fordert und sich um die Triebbegründung derselben nicht kümmert’, sogar bestrebt ist, die ‚sittlichen Anforderungen möglichst hoch zu spannen‘. Auf diese Weise erklärten sich nicht nur die zahlreichen neurotischen Pathologien, sondern – und hier kommen wir auf den Krieg zurück – man erziehe den Menschen zu reinem Kulturgehorsam, der äußerst fragil sei“ (S. 96).
Mit anderen Worten: Auch die „Gutmenschen“ können ihre aggressiven Triebe oder „das Böse in sich“ nicht komplett auslöschen. Und genau deshalb ist es auf der politischen Ebene eine ausgesprochen destruktive Herangehensweise, die Staaten des politischen Westens grundsätzlich als die Guten zu betrachten, und Staaten wie Russland, China und andere Staaten mit autoritären Regimen grundsätzlich als die Bösen. Und hier, das ist jetzt meine Schlussfolgerung (Flaßpöhler denkt wohl auch in diese Richtung, deutet dies auf S. 95 unten aber nur sehr vorsichtig an), liegt auch der Grund dafür, warum den in ihrem Selbstbild so guten, vernünftigen und sensiblen Grünen oft so viel Feindseligkeit entgegenschlägt: Es ist eine Reaktion auf deren eigene Feindseligkeit und Aggression, die stets mit einer moralisierenden Selbstgerechtigkeit kombiniert ist – und sie blind macht für ihre eigene Feindseligkeit und lustvolle Aggression. Diese Aggression drückt sich zum Beispiel in einem inquisitorischen Verfolgungsdrang gegenüber „politisch Unkorrekten“ aus, die auch vor den eigenen Mitgliedern nicht Halt macht. So musste sich zum Beispiel die Spitzenkandidatin der Berliner Grünen umgehend einem Entschuldigungsritual unterziehen, als sie auf einem Parteitag spontan auf eine Frage zu ihrer Biografie geantwortet hatte, dass sie auch als Kind schon gerne die Rolle des Indianerhäuptlings eingenommen habe. Für die Normalos unter den Lesern: „Indianer“ ist in grünen Kreisen ein furchtbar böses Wort, das man nicht in den Mund nehmen kann, ohne sich selbst mit Bosheit und moralischer Verwerflichkeit zu infizieren. Ein anderes Beispiel: Die Grünen, bei ihrer Gründung noch explizite Pazifisten, sind derzeit außenpolitisch die nach meinem Eindruck militaristischste und aggressivste Partei im Deutschen Bundestag. Und das wird natürlich gelabelt als „Kampf für Menschenrechte, Demokratie und Freiheit“. Ohne dass ich das jetzt im Detail geprüft habe, wage ich die These, dass selbst die rechtsradikale AFD außenpolitisch friedfertiger ist, als es die Grünen sind.
Aggression ist eine für das Leben notwendige psychische Struktur
Flaßpöhler zieht aus den zitierten Überlegungen von Freud (und außerdem Ernst Jüngers „Essay über den Schmerz“) die Schlussfolgerung, dass der Unterdrückung der aggressiven Triebe des Menschen – im Interesse einer sensibleren und gerechteren Gesellschaft – eine Dialektik innewohnt, die zum gegenteiligen Ergebnis führen kann. Und vor allem: Dass es nicht möglich ist, jeglichen Schmerz aus dem Leben zu verdrängen. Und dass dies nicht nur nicht möglich ist, sondern auch ein gutes Leben verhindert, weil zu viel Sensibilität und Sicherheitsstreben unsere Vitalität zerstört. Denn den archaischen Triebkräften wohne auch eine Fähigkeit zur Resilienz inne, wie Flaßpöhler mit Blick auf Kriegsopfer formuliert:
„Es braucht mitunter lange, bis ein Mensch begreift, was ihm widerfahren ist. Doch: Er hat überlebt. Etwas in ihm hat ihn nicht sterben lassen. Diese aus der Todesangst geborene Kraft entbindet sich unbewusst im Moment der Gewalt. Sie entspringt ebenjenem unbändigen, urgeschichtlichen, unbewussten Lebensdrang (…). Ein Antrieb, der den Menschen über sich hinaushebt, ohne dass er selbst sich intentional dazu entschließen könnte. (…) Sie geschieht dem Subjekt vom Triebgrund her. Diese Kraft ist es, die das Opfer im entscheidenden Moment gerettet hat“ (S. 119-120).
Und diese Kraft ermögliche es auch,
„die lebensbedrohliche, existentielle Krise zu bewältigen, gar gestärkt aus ihr hervorzugehen“ (S. 120).
In meinen Worten ausgedrückt: Aggression ist nicht per se etwas Schlechtes, sondern im Gegenteil eine für das Leben notwendige psychische Struktur: Um sich wehren zu können, um kein hilfloses Opfer zu werden, aber auch um ganz banale Aufgaben des alltäglichen Lebens zu bewältigen, um etwas „in Angriff zu nehmen“ (eine der Bedeutungen des lateinischen Wortes „aggredere“, von dem das Wort Aggression abgeleitet ist), wie etwa die Suche nach einer neuen Wohnung. Und deshalb ist es falsch, Aggression aus dem Leben verbannen zu wollen. Denn es ist gar nicht möglich. Sie ist ein Teil der menschlichen Seele, wie das Herz ein unverzichtbarer Teil des Organismus. Und wäre das Leben nicht furchtbar schal, wenn wir alle nur noch lieb zueinander wären, und es nicht einmal mehr die sublimierten und zivilisierten Formen der Aggression, wie zum Beispiel Ironie, Polemik, Spott oder derbe Sprache gäbe?
Wichtig ist es vielmehr, sich der eigenen aggressiven Triebe bewusst zu sein und sie in konstruktive Bahnen zu lenken. Wer sie aber leugnet und an sich selbst nur noch das Gute und moralisch Reine sehen will, der wird eines Tages von seinen verleugneten aggressiven Trieben eingeholt und beherrscht werden. So wie es der Film „Falling Down – ein ganz normaler Tag“ zeigt. Michael Douglas spielt darin einen überangepassten Kleinbürger, dem ein doppeltes Unglück widerfahren ist: Er verlor seine Anstellung und seine Frau hat ihn verlassen. Aus dem überangepassten Kleinbürger wird dadurch schließlich ein vor Aggression überschäumender Gewalttäter, der bei den kleinsten Anlässen explodiert und schließlich zum Mörder wird und dann selbst von der Polizei erschossen wird. Sein aggressiver Schatten, den er in seiner Überanpassung stets unterdrückt hatte, ist eben durch dieses Übermaß an Anpassung (= Aggressionsunterdrückung) nicht mehr zu bändigen gewesen.
Flaßpöhlers Schlussfolgerung
Flaßpöhlers Schlussfolgerung aus ihrer Reflektion diverser psychologischer, soziologischer und philosophischer Autoren ist, dass Empathie keineswegs nur einseitig positiv zu sehen ist:
„Es ist richtig und wichtig, das Leiden Betroffener nachzuempfinden, mit ihnen mitzufühlen. Nur so erfährt erlittenes Unrecht Anerkennung. Nur so gibt es die Chance auf Gerechtigkeit. Doch ist die reine Empfindung noch keine Moral. Nichts kann von der Notwendigkeit des Urteils und der damit einhergehenden Distanzierung entbinden. Denn nicht alles, was nachempfunden werden kann, verdient Solidarität und Anerkennung. Als Gefühl birgt die Empathie selbst tiefe Abgründe. Ihre dunkle Seite ist der Lustgewinn, der sich aus fremden Leid ziehen lässt. Diese Seite zeigt sich auch dann, wenn man Menschen regelrecht in Opferpositionen gefangen hält. Etwa, indem man paternalistisch für andere spricht, sich schützend vor sie stellt und an ihrer statt sagt, welche Begriffe sie diskriminieren. Oder indem man Frauen auf hilflose Wesen reduziert“ (S. 90-91).
Und ganz am Schluss ihres Buches schreibt sie resümierend:
„Wird die Sensibilität verabsolutiert, führt sie zu einem problematischen Menschenbild. Wenn Wörter mit Verletzungsrisiko weiträumig zu umgehen respektive vollkommen kontextunabhängig zu tilgen sind; wenn Ausstellungen, in denen Motive mit negativem Assoziationspotenzial zu sehen wären, nicht stattfinden können; wenn Menschen ihre Arbeit verlieren, wenn sie sich angeblich verletzend geäußert haben, dann sind Freiheit und Autonomie in Gefahr. Überspitzt formuliert: Der Mensch droht zu einer offenen Wunde zu werden, die vor jedem Infektionsrisiko zu schützen ist. Der Ruf nach institutioneller und staatlicher Kontrolle wird entsprechend lauter. Damit wäre das andere Extrem des Unzumutbaren benannt: Dem ingoranten, reaktionären Political-Correctness-Polemiker auf der einen Seite entspricht auf der anderen ein sensibles Selbst, das allen Schutz von der Welt erwartet, von sich selbst hingegen: nichts“ (S. 212).
Resümee
Flaßpöhlers Buch umfasst noch sehr viele andere Aspekte, Theorien und Argumente, die ich im Rahmen dieser Besprechung nicht alle erwähnen kann. Sie hat aus meiner Sicht ein sehr lesenswertes Buch geschrieben, aber zwei Einwände habe ich doch. Erstens: Wenn man ihr Werk mit dem Buch „Erwachsenensprache“ des österreichischen Philosophen Robert Pfaller vergleicht, dann fällt auf, dass man bei Robert Pfaller klare Positionierungen, Urteile und Botschaften zu lesen bekommt. Das habe ich in einigen Kapiteln von Flaßpöhlers Buch vermisst. Ich war bei der Lektüre ab und zu frustriert, weil man ihren Standpunkt nicht so recht fassen konnte. Da hätte ich mir gewünscht, sie hätte öfter ganz klar Position bezogen. Mein zweiter Einwand: Sie hinterfragt die Motive der Politischen Korrektheitsbewegung nicht. Mit anderen Worten: Sie nimmt deren Motive ernst, unterstellt den Politisch Korrekten also integre Motive. Aber, ob bewusst oder unbewusst: Dies kann, muss aber durchaus nicht der Fall sein. Dahinter steckt m. E. ebenso Narzissmus und das Bedürfnis nach Selbsterhöhung, eine Klassenideologie, eine Machtstrategie und ein Geschäftsmodell. Denn mit Politischer Korrektheit kann man heutzutage auch viel Geld verdienen. Viele Unternehmen engagieren inzwischen Antirassismusberater und schulen ihre Mitarbeiter in sensibler Sprache. Und Politische Korrektheit ist auch ein Machtinstrument. Allerdings tut dieser Einwand der Qualität des Buches von Svenja Flaßpöhler keinerlei Abbruch. Sie hatte eben ein anderes Erkenntnisinteresse und wollte die Frage moderner Empfindlichkeit mehr aus deren Eigenlogik betrachten. Insgesamt betrachtet war ihr Buch eine interessante Lektüre. Ich kann es deshalb empfehlen. Wäre dies eine Amazonrezension, würde ich wegen der genannten Einwände aber nur 4 von 5 möglichen Sternen vergeben.
Svenja Flaßpöhler: Sensibel. Über moderne Empfindlichkeit und die Grenzen des Zumutbaren, Klett-Cotta 2021, 240 Seiten, 20 Euro.