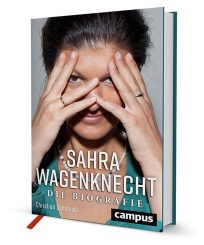Der katholische Theologe Jonas Christopher Höpken bespricht die Biografie Sahra Wagenknecht von Christian Schneider. Eine interessante Konstellation, eine interessante Besprechung. Albrecht Müller
Von Jonas Christopher Höpken *
Sahra Wagenknecht ist gar keine richtige Politikerin. Das politische Handwerk ist ihr eigentlich fremd. Sie kann nicht netzwerken, ist keine Rudelführerin. Sie nennt sich zwar immer noch Fraktionsvorsitzende, aber “die Fraktion zu führen, das macht eigentlich Dietmar Bartsch.” Dies sind keine Zitate von politischen Gegnern und auch keine Urteile ihres Biographen Christian Schneider. Letzterer hat diese Aussagen vielmehr Sahra Wagenknecht selbst und ihren engsten Weggefährten entlockt. Schneider hat für sein Buch viele Gespräche geführt: mit Sahra Wagenknecht selbst, ihrem Lebenspartner Oskar Lafontaine, ihrer Mutter, ihrer Kindheitsfreundin Beate.
Aber ist dann nicht der politische Hype um Sahra Wagenknecht nur ein großes Missverständnis? War und ist es ein Irrtum so vieler Menschen, auf sie zu setzen? Diese Schlussfolgerung ist zumindest nicht das, was Christian Schneider seinen Leserinnen und Lesern vermitteln will. Sein Anliegen ist vielmehr zu begründen, warum Wagenknecht zu der geworden ist, die sie ist: zu der Frau, die den politischen Diskurs in Deutschland in den letzten Jahren geprägt und polarisiert hat wie keine andere Oppositionspolitikerin – erst recht keine andere Linke. Was macht sie in ihrem Innersten aus?
Um das herauszubekommen, taucht Schneider tief in die Psyche von Sahra Wagenknecht ein. Sie hat das zugelassen, obwohl nicht alles schmeichelhaft für sie ist, was der habilitierte Sozialpsychologe analysiert und zusammenfügt. Sein Buch ist keine Biographie im herkömmlichen Sinne, sondern auch ein – öffentliches – Psychogramm. Aber gleichzeitig ein sehr politisches Buch, das die dramatische Entwicklung dieser Ausnahmeerscheinung auf der bundesrepublikanischen Bühne beschreibt.
Als wesentlichen Faktor der inneren Dynamik Wagenknechts identifiziert Schneider den frühen Verlust ihres Vaters. Der Iraner verlässt Deutschland, als Sahra 2 1/2 Jahre ist. Er ist nicht tot, sondern einfach weg, was die Verarbeitung des Verlustes nicht einfacher macht. Schneider beschreibt eine die nächsten Jahrzehnte prägende Treue Wagenknechts zum verlorenen Vater, die nach seiner Interpretation sogar den späteren Einstieg Wagenknechts in die Öffentlichkeit mit beeinflusst; es könnte ja sein, dass sich dieser politische Aufstieg bis in den Iran herumspricht und sich der Vater ihr doch noch einmal zuwendet.
Wer sich schon vor der Lektüre dieser Biographie mit Sahra Wagenknecht beschäftigt hat, weiß um ihr Interesse für Goethe. Was ihr Biograph im Gespräch mit ihr und ihrem Umfeld analysiert, macht aber deutlich, dass es hier nicht um ein literarisches Hobby geht, sondern um eine regelrechte Obsession für diesen Dichter, in dessen Lebenswelt Wagenknecht sich tief hineinbegibt und zu dem sie eine nahezu transzendente Beziehung entwickelt – dabei die Grenzen von Raum und Zeit überspringt. Ihre Freundin Beate ist sich im Gespräch mit Schneider sicher: Wagenknecht und Goethe “hätten sich kennengelernt, wenn sie damals oder er heute gelebt hätte. Sahra, da ist sich Beate sicher, hätte es geschafft.” Sie meint das sehr ernst.
Schneider identifiziert Goethe als den ersten, “der so zu ihr gesprochen hat, dass ein neuer Ton in ihre Welt kam” und sie damit aus der Sphäre ihres Vaters, in der sie sich verfangen habe, herausholen konnte. Doch gelingt es auch Schneider nicht, die genauen Gründe von Wagenknechts Faszination für Goethe wirklich zu identifizieren. Sie thematisiert im Gespräch mit ihm aber die Bedeutung der zu Beginn von Goethes Faust beschriebenen Szene im Mondlicht, das für sie so etwas wie der Souffleur einer anderen Welt ist, die sie selbst in ihrem Anderssein und ihrer Sehnsucht nach einem anderen Leben begleitet.
Goethe steht aber natürlich stellvertretend auch für die Welt des Geistes und die der Wörter, die für sie so wichtig ist. Das Lesen hochwertiger Literatur ist für Sahra Wagenknecht mehr als Glück – es ist in der Analyse Schneiders Nahrung, ohne die sie krank wird und zu verhungern droht; was entscheidender Faktor ihrer Erkrankung im Frühjahr 2019 war. Doch fehlen der jungen Sahra in ihrer Vertrautheit mit Goethe real lebende ebenbürtige Gesprächspartner. Wenn sie schon Goethe nicht leibhaftig kennenlernen kann, so nimmt sie 1987 mit einem poetischen, in der Biographie in persisch verfremdeter Originalschrift abgedruckten Brief Kontakt zu dem Dichter Peter Hacks auf, der darauf eingeht und mit dem sich eine enge Gesprächsbeziehung entwickelt. Hacks wird für die junge Sahra Wagenknecht in der Darstellung Schneiders zu einer alles überstrahlenden Gestalt, in der sich ihr Traum materialisiert – ja zu einem “platonisch geliebten Übervater”.
Aber es gibt, womit Schneider seine Leser abrupt konfrontiert, einen seltsamen Kontrast zwischen Wagenknechts sprachsensibler Stilbildung durch Goethe, Hegel und durchaus auch Marx auf der einen Seite und dem formelhaften funktionärsdeutschen Politsprech, in den sie gerade in der Anfangszeit ihrer politischen Tätigkeit fällt auf der anderen Seite. “War mit ihrem Eintritt in die Partei das Ende des Schöngeistigen gekommen?”
Dass diese Frage aus heutiger Sicht wohl nicht bejaht werden muss, ist ein Hinweis für die dramatische Entwicklung der politischen Ausrichtung Wagenknechts, die Schneider nachzeichnet. Was sich seit ihrer überraschenden Wahl in den PDS-Parteivorstand 1991 verändert, ist nicht die in der Anfangszeit ihres parteipolitischen Lebens sehr stark betonte marxistische Ausrichtung, die entgegen dem Klischee nie orthodox war; vielmehr spricht sie sich – so in ihrer von Schneider beschriebenen Auseinandersetzung mit der Wirtschaftspolitik Ulbrichts – schon früh für die Integration von Leistungsdenken und Wettbewerb in die Sozialismuskonzeption aus; dieser Ansatz von ihr ist entgegen dem allgemeinen Klischee nicht erst neueren Datums. Es geht vielmehr um die angesichts ihres intellektuellen Horizonts erstaunlich unkritische Haltung zur DDR, deren Verhältnisse Wagenknecht in der Konkretion zwar in vielen Punkten von Anfang an kritisiert, in der Abstraktion aber lange verteidigt, was zu realen Verengungen in ihrem Leben führt; so erklärt die heutige Saarländerin noch Mitte der 90er Jahre, sie könne sich nicht vorstellen, in Frankfurt am Main oder in Hamburg zu leben. Ihre Heimat war das Gebiet der ehemaligen DDR – obwohl sie, die Individualistin mit ihren von Schneider bescheinigten autistischen Zügen, unter der Konformität dieses Staates, der ihr das Studium verwehrte, wirklich gelitten hat und, wie sie gegenüber Schneider sagt, erst durch die von ihr politisch so verurteilte Wende aus dieser ziemlich ausweglosen Situation befreit wurde.
Wie konnte es vor diesem Hintergrund zu der vermeintlich “stalinistischen” Sahra Wagenknecht der ersten Hälfte der 90er Jahre kommen? In den Parteivorstand lässt sie sich mit dem realen Gefühl wählen, “mit Anfang 20 die ganze Weltphilosophie durchgelesen” zu haben – und jetzt im Führungsgremium der PDS auf eine Mauer aus Opportunisten zu stoßen, die sie ihre starke Ablehnung spüren lassen. Und nichts hasst Sahra Wagenknecht mehr als Opportunismus; dies betont Schneider mehrmals. Er beschreibt, wie Wagenknecht aber auch in dieser Situation mit Michael Benjamin auf einen männlichen Gesprächspartner trifft, mit dem sie sich verbündet und gemeinsam einen bemerkenswerten Gegenentwurf für ein neues Programm der PDS entwirft, dem Schneider eine beachtliche Analyse der Gegenwart (“eine verheerende Bestandsaufnahme der kapitalistischen Welt”) bescheinigt, aber auch ein “erschütterndes” Festhalten an alten Gewissheiten und einen “Überhang allgemeiner programmatischer Forderungen nach Art alter sozialistischer Parolen”.
Schneider beschreibt, wie sich diese politische Ausrichtung Wagenknechts seit Mitte der 90er Jahre langsam verändert, als in ihrem Denken “an die Stelle der nostalgischen Vergangenheit die Perspektive einer möglichen Zukunft” tritt. Im inneren Zirkel der PDS spielt sie nach der von Gysi und Bisky betriebenen Herausdrängung aus dem Parteivorstand 1995 für lange Zeit keine wirkliche Rolle mehr. Sie lernt Ralph Niemeyer kennen und heiratet ihn; auf Schneider wirkt diese Ehe eher wie “eine Auszeit, eine nette Urlaubsbeziehung” für Sahra Wagenknecht. Sie studiert Philosophie und denkt über eine akademische – was soll man schreiben: Laufbahn? Karriere? – nach. Sich einbinden, einengen lassen – alles sträubt sich bei Sahra Wagenknecht dagegen, trotz sehr realer Existenzängste und Zukunftssorgen. Gleich an zwei Stellen erwähnt Schneider den Widerwillen Wagenknechts dagegen, sich Bewerbungsgesprächen zu unterziehen. “Sic!” – würde der Hiwi hier einfügen.
Wagenknecht bemerkt zudem, dass die Philosophie allein nicht ausreicht, um die Welt zu erfassen und wendet sich der Ökonomie zu. Sie studiert mit dem Ziel der Promotion – und verändert ihre Weltsicht. Schneider terminiert den nach außen sichtbaren Zeitpunkt der inneren Wende in Sahra Wagenknechts Politikverständnis auf 1998. In diesem Jahr veröffentlicht sie ihr Buch “Kapital, Crash, Krise”, in dem sie einen fiktiven Dialog über verschiedene ökonomische Ansätze führt. Dem folgt in ihrem wirklichen Leben eine Reihe an realen Dialogen. Sahra Wagenknecht wird trotz ihrer nicht mehr vorhandenen parteipolitischen Rolle immer mehr zu einer öffentlichen, medial präsenten Figur, die weitere Bücher schreibt, in Talkshows eingeladen wird und zur anerkannten Gesprächspartnerin über politisch-ökonomische Fragen wird. Sie verändert ihre Sprache und wird zu der Sahra Wagenknecht, als die sie heute wahrgenommen wird – “ohne den agitatorischen Politsprech”, wie Schneider es ausdrückt. Schneider trifft aber nicht den Kern, wenn er Wagenknecht bescheinigt, dass sie sich mit ihrer in dieser Zeit stattfindenden Emanzipation von der Kommunistischen Plattform auch “von den Fesseln des marxistisch genormten Denkens befreit”. In der Tat nimmt sie in dieser Zeit aber “Abschied von den denkeinschränkenden Illusionen der alten DDR-Orientierung”. Die Fixierung auf eine vermeintlich positive Ost-Vergangenheit streift sie ab und ersetzt sie durch eine “Gegenwartsbeschreibung, die neue Möglichkeiten der Veränderung aufzeigt”. Die Gesellschaft analysieren und für ihre Veränderung eintreten – nein, ein Abschied von Marx ist das nicht. Aber es ist die Öffnung ihrer Türen für die Menschen, die von sozialistischen Veränderungen profitieren sollen. Die Sahra Wagenknecht der ersten Hälfte der 90er Jahre erreicht diese Menschen nicht. Die veränderte Sahra Wagenknecht zeichnet sich durch das Gegenteil aus: Menschen in einem Ausmaß für sich und die eigenen Politik gewinnen zu können wie fast niemand sonst auf linker Seite.
Zuerst geschieht dies weiterhin innerhalb der Ost-Partei PDS. Aber Sahra Wagenknecht trifft 1998 eine ungewöhnliche Entscheidung und tritt als einzige prominente PDS-Vertreterin in einem westdeutschen Wahlkreis an, nämlich in Dortmund, wo sich für sie, wie Schneider sie zitiert, “völliges Neuland” ergibt. Sie lernt erstmals Langzeitarbeitslose kennen, ist erstaunt über die völlig separierten Milieus im Westen, die keinerlei Berührung miteinander haben. Schneider interpretiert diese Westerfahrung Wagenknechts als den entscheidenden Ausgangspunkt ihres neuen Ansatzes, die Welt zu verstehen. Nachdem ihr der Einzug in den Bundestag nicht gelingt – es wäre die erste von mehreren nie zur Verwirklichung gekommenen Optionen gewesen, mit Oskar Lafontaine zusammen im selben Bundestag zu sitzen -, kandidiert sie 2004 wiederum für einen westdeutschen, nämlich den niedersächsischen Landesverband für das Europaparlament; diesmal erfolgreich. Die fünf Jahre, die sie dort verlebt, beschreibt Schneider allerdings als abschreckend, nämlich als Erfahrung der Einflusslosigkeit der Parlamentarier auf der einen und ihrer skrupellosen Indienstnahme durch Lobbyisten auf der anderen Seite – wobei beides gleichzeitig allerdings nicht ganz schlüssig ist.
Die PDS erlebt Wagenknecht in dieser Zeit als “sterbende Partei”: ohne jegliche Bedeutung im Westen, mit schwindender Verankerung im Osten. Was dann folgt, nennt Schneider ein “politisches Märchen”. Die Auferstehung oder besser das Aufgehen der PDS in eine gesamtdeutsche Linke erzählt er nicht nur einfach am Beispiel von Sahra Wagenknecht und dem neuen Mann an ihrer Seite, Oskar Lafontaine, sondern er deutet die neue Partei letztlich als “Kind des sich damals findenden Paares”, als lebendige Schöpfung einer wirklich großen Liebe zweier Menschen. Lächerlich wirkt das nicht, auch wenn das Kind heute gegen seine beiden Eltern rebelliert.
Insider werden es wissen, der Rezensent wusste es so noch nicht: Die Liebe zwischen Wagenknecht und Lafontaine ist keine, die sich während der Parteineubildung langsam entwickelt, bis sie 2011 schließlich öffentlich gemacht wird, sondern sie beginnt mit großer Wucht bereits 2005 auf einer gemeinsamen Pressekonferenz der beiden, die “nicht weniger als ein Wunder” bewirkt. Schneider, der offensichtlich mit beiden Betroffenen getrennt voneinander über diese Situation gesprochen hat, spricht von einer überraschenden und unerklärlichen wechselseitigen Anziehung, einer irritierenden emotionalen Nähe, einer untergründig wirkenden Anziehungskraft wie in Goethes “Wahlverwandtschaften”. Während bei Lafontaine der “Reiz der Abweichung” eine Rolle gespielt habe, seien bei Wagenknecht “vom ersten Moment an starke Gefühle” im Spiel gewesen. Schneider scheut sich nicht, in diesem Zusammenhang wieder auf den Vaterverlust der kindlichen Sahra anzuspielen, indem er von der Hoffnung spricht, “nun die Leerstelle zu füllen, die seit ihrer Kindheit schmerzte, ein Wunsch, der seinen genuinen Platz eigentlich nur in einem Märchen finden konnte”; dabei zitiert er Lafontaine, der “ebenso ironisch wie ernst” gesagt habe, er sei ja wohl so etwas wie ein Ersatzvater für Sahra Wagenknecht. Angemessener erscheint Schneiders Bemerkung, Wagenknecht habe in Lafontaine “endlich den Dialogpartner gefunden, den sie ihr Leben lang suchte”. Nach Goethe, Hacks, Niemeyer und Benjamin eine Erfüllung.
Schneider sieht objektiv eine starke Verknüpfung dieser über längere Zeit geheim gehaltenen Liebesgeschichte mit dem politischen Vereinigungsprozess der Linken; er spricht von einer „doppelten Vereinigung“, was die Geschichte von Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine zu einem politischen Märchen mache. Tatsächlich schritten die Parteineubildung und der Aufstieg der Linken unaufhaltsam voran, so lange die persönliche Liebe der beiden entscheidenden Frontleute ihrer jeweiligen Parteien geheimgehalten war.
Schneider beschreibt die Beziehung Sahra Wagenknechts zu Oskar Lafontaine freilich nicht nur als entscheidend für die Entwicklung der neuen Partei, sondern auch für ihre eigene. Was die Politikerin Wagenknecht heute ausmache, resultiere aus einem kontinuierlichen Lernprozess, für den ihre Begegnung mit Lafontaine entscheidende Impulse geliefert habe; im selben Atemzug schreibt Schneider, für den die Entwicklung dieser Beziehung mit der Entwicklung der neuen Partei ja quasi identisch ist, zumindest wesentlich daraus resultiert: “Ist die Gründung der Linkspartei also eine Art Neustart ihres Lebens?” Er bejaht dies und betont die tragende Rolle, die Wagenknecht nun zunehmend in der Linken einnimmt. Indem Lafontaine aus der rechtssozialdemokratischen PDS durch die Vereinigung mit der WASG eine linkssozialdemokratische Partei gemacht habe, habe er Wagenknecht aus ihrer kompletten Außenseiterrolle herausgeholt. Damit habe sich für sie ein Politikfeld aufgetan, das erstmals nicht von den permanenten innerparteilichen Anfeindungen dominiert wurde – was sich wieder ändern sollte, als das gemeinsame Kind in die frühe Pubertät kam.
Lafontaines Rolle als Diskussionspartner, Ideenproduzent und Unterstützer für Sahra Wagenknecht ist für Schneider nicht hoch genug zu bewerten, weil er all das in das politische Zweigestirn einbringe, was ihr abgehe. Lafontaine ist der Rudelführer, Wagenknecht dagegen die “charismatische Einzelfigur” – für Schneider wiederum eine Folge ihres Vaterverlusts. Wagenknecht fehle die Fähigkeit, skrupellos ihre Interessen durchzusetzen. Lafontaine staune auch “über ihren Mangel an strategischer Lüge und Aggressivität”. Stattdessen zeichne sie sich durch “Präzision in der Argumentation” aus – was wiederum ihre Gegner aggressiv mache. Die Argumentation Schneiders, Lafontaine bringe also das ein, was Wagenknecht nicht habe, ist mit diesen Beispielen nicht ganz schlüssig; denn durch die Beziehung zu Lafontaine verändert sich in Wagenknechts Charakter in den genannten Punkten ja nichts – glücklicherweise, werden die meisten ihrer Anhänger sagen. Dass sich hier zwei Menschen gefunden haben, die mit ihren tiefen Gemeinsamkeiten, aber auch ihren unterschiedlichen Charakteren die Linke über Jahre stark geprägt haben und von denen die Partei in dieser Zeit sehr profitiert hat, ist jedoch offenkundig.
Schneider macht dann noch einen zweiten, überzeugenderen Anlauf zu erklären, in welchem Sinne ihre Beziehung zu Lafontaine Sahra Wagenknecht in ihrer politischen Ausrichtung verändert habe: ihre Anfang der 90er Jahre noch gar nicht vorhandene, ihre Persönlichkeit aber heute deutlich ausmachende Praxis, die eigenen politischen Vorstellungen dem ständigen Dialog auszusetzen, dadurch weiter zu entwickeln und so zu formulieren, dass sie immer mehr auch der Frage nach der politischen Umsetzung gerecht würden. Exemplarisch deutlich macht Schneider das anhand ihrer beiden letzten Buchveröffentlichungen “Freiheit statt Kapitalismus” und “Reichtum ohne Gier”, in denen sie auf hohem theoretischen Niveau ein überzeugendes und in der Sache praktikables Alternativmodell zum gegenwärtigen Kapitalismus entwickle. Nicht geklärt sei darin allerdings die nicht unerhebliche Frage, wie man die politischen Entscheidungsträger dazu bringen könne, angesichts der zu erwartenden Widerstände das theoretisch Umsetzbare in der Praxis tatsächlich wirksam werden zu lassen.
Natürlich kommt Schneider auf die Entwicklung Sahra Wagenknechts nach dem Rückzug Lafontaines von der bundespolitischen Bühne zu sprechen. Ihre erste Legislaturperiode ab 2009 habe sie als ihre glücklichste in Erinnerung, wobei die Partei selbst ohne ihren Gründungsvorsitzenden in dieser Zeit durchaus schon eine Krise durchlebt. Schneider beschreibt die Kämpfe um die Fraktionsspitze, die 2015 von Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch übernommen wird. Leider unterbelichtet lässt Schneider die Frage, wie es dazu kommen konnte, dass die Zusammenarbeit ausgerechnet dieser beiden so gegensätzlichen politischen Köpfe entgegen aller Voraussagen so gut funktioniert – wenn man bedenkt, dass zwischen Wagenknecht und Lafontaine auf der einen sowie Bartsch auf der anderen Seite über viele Jahre ein tiefer, auch von persönlichen Verletzungen geprägter Graben verlief. Auch wie es umgekehrt passieren konnte, dass zwischen Wagenknecht/Lafontaine und dem von beiden 2012 faktisch in den Parteivorsitz gehobenen Bernd Riexinger ein so desaströses Zerwürfnis entstehen konnte, wird nicht wirklich thematisiert. Vielleicht ist beides noch zu sehr mit der Gegenwart verknüpft, als es in dieser Biographie angemessen zu verarbeiten.
Deutlich sind dagegen die Worte zu “aufstehen”, der Bewegung, von der sich viele Anhänger Sahra Wagenknechts eine neue kraftvolle Plattform für sie ohne hasserfüllte Gegner erhofft hatten. Von Schneider nach ihrem größten politischen Fehler befragt, antwortet Wagenknecht: ” ‘Aufstehen’ nicht gut vorbereitet zu haben”. Sie habe hier eine größere Eigendynamik erwartet, kein klares Konzept gehabt und sich “ein bißchen treiben lassen” von dem Eindruck, dass sich nach dem guten Anfang alles weitere ergeben würde. Wenn man bedenkt, mit welcher Leidenschaft Wagenknecht dieses Projekt zunächst vorangetrieben, in seiner Gewichtigkeit betont und als “vielleicht letzte Chance” beworben hatte, in absehbarer Zeit eine Veränderung von links herbeizuführen, staunt der politische Betrachter an dieser Stelle.
In der Beschreibung des angekündigten Rückzugs Sahra Wagenknechts von der Fraktionsspitze kommt Schneider auf den Leipziger Parteitag 2018 zu sprechen. Die Kontroverse um die Migrationspolitik mit den Angriffen auf Wagenknecht thematisiert er, leuchtet sie aber nicht wirklich aus. Da diese Frage in dem facettenreichen Bild Sahra Wagenknechts in jüngster Zeit so vieles überlagert, wäre es interessant gewesen, dieser Konfliktlinie und der Frage, wie sie so in den Vordergrund rücken konnte, stärker auf den Grund zu gehen. Aber diese Kontroverse ist für Schneider nur ein kleiner Flügel der politischen Mühle, die Wagenknecht in eine “perfide Krankheit” führt; von Schneider erstaunlich unmedizinisch und umgangssprachlich als “burn out” identifiziert. Schneider schreibt von einem langen Prozess Wagenknechts in diese Krankheit und deutet diese als “Ausnahmesituation, die es ihr gestattete, den Irrsinn der Normalität zu erkennen”. In der Auszeit habe sie zum ersten Mal seit Jahren wieder ausreichend von dem Stoff bekommen, der sie satt mache und ihrem Leben Sinn verleihe – den Wörtern, der Literatur. Neben dieser hat Wagenknecht aber, wie Lafontaine betont, nicht zuletzt auch das notwendige Maß an Unterstützung und Rückendeckung aus den eigenen Reihen gefehlt, die gerade eine Einzelgängerin wie sie brauche, um im politischen Alltag zu bestehen.
Am Schluss seines Buches stellt Schneider die Frage, worin der von Goethe als für die Lebensgeschichte von Menschen als entscheidend identifizierte Knoten im Leben Sahra Wagenknechts besteht. Er kommt dabei noch mal auf ihren Vaterverlust zu sprechen, der Stigmatisierung „durch die Mitgift einer Person, die sie geliebt und verloren“ habe. Ihr lebensgeschichtlicher Knoten bestehe in der Verknüpfung dieses frühen Verlustes mit dem Wunsch, das Verlorene präsent zu halten und sich selbst damit lebensfähig zu machen: anders sein zu dürfen, ohne deshalb ausgegrenzt oder entwertet zu werden: „Es ist der Wunsch nach einem Zustand, in dem Freiheit der Selbstentfaltung nicht mit dem Verlust von persönlicher und sozialer Sicherheit bezahlt werden muss.“ Wagenknechts politisches Leben kreise zu einem guten Teil darum, einen Ausgleich zwischen der Treue zu ihren Idealen und dem Einlassen auf den notwendigen Dialog zu führen. Einem Dialog, der erstaunlicherweise mit der Außenwelt oft leichter zu führen zu sein scheint als mit den so oft nur vermeintlich politisch Verbündeten.
Gregor Gysi hat vor kurzem betont, Sahra Wagenknecht sei „keine Göttin“. Nein, sicher nicht – aber ein Ausnahmemensch ist sie schon. Das atemberaubende Ausnahmebuch von Schneider mit tiefen, teils grenzüberschreitenden Einblicken in ihr Inneres scheint dem angemessen zu sein.
Christian Schneider: Sahra Wagenknecht. Die Biographie. Frankfurt/New York 2019.256 Seiten.
* Jonas Christopher Höpken, Jahrgang 1972, lebend und arbeitend in Oldenburg, ist katholischer Theologe.