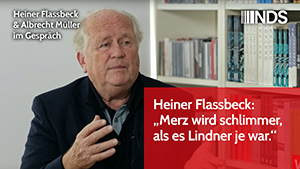Der am 2. April mit großem Tamtam ausgerufene „Liberation Day“ ist mittlerweile Geschichte. Trumps Ankündigung für „reziproke Zölle“ gegen Gott und die Welt hielt ganze acht Tage, dann musste der wohl mächtigste Mann der Welt seine Zölle wieder zurücknehmen, da die noch mächtigeren Anleihenmärkte verrückt spielten und die Refinanzierbarkeit der US-Schulden zu kippen drohte. Was übrigbleibt, ist die Wiederauflage des Handelskriegs gegen China – Ausgang offen. Verständlich, dass nun Spekulationen und Erklärungsversuche ins Kraut schießen. Ging es Trump womöglich gar nicht um Zölle? Hat China ihn in der „ersten Schlacht“ des Handelskriegs besiegt? Steckt hinter dem erratischen Verhalten eine tiefere Strategie? Auf keine dieser Fragen gibt es überzeugende Antworten. Ein Deutungsversuch von Jens Berger.
Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.
Podcast: Play in new window | Download
Dass US-Präsident Donald Trump kein Freund des Freihandels ist, machte er der Welt bereits in seiner ersten Amtszeit klar. Wer denkt, er sei ein bedingungsloser Verfechter protektionistischer Politik, liegt jedoch auch falsch. Sein Motto „America first“ ist hier durchaus ernstzunehmen. Ideologische Scheuklappen scheinen ihm fremd zu sein. Seine Handelspolitik ist vielmehr dadurch gekennzeichnet, dass er internationale Abkommen und Konventionen ignoriert und seine eigene Mischung aus Freihandel und Protektionismus zusammenschustert, die seiner Meinung nach der USA am meisten nützt – „Make America great again“ halt.
Und bereits hier sind die ersten Zielkonflikte zwischen seiner Rhetorik und seiner Zollpolitik zu erkennen. Natürlich weiß auch Trump, dass Zölle nie Zusatzeinnahmen generieren können, mit denen er Steuererleichterungen refinanzieren kann. Zölle sind nämlich ein zweischneidiges Schwert. Wenn sie wirklich wirken, gehen die Importe spürbar zurück – dann gibt es jedoch auch keine zusätzlichen Zolleinnahmen. Wenn sie nicht wirken, verteuern sie ganz einfach nur die importierten Produkte und liefern zwar Einnahmen, führen aber nicht dazu, dass im Land selbst Jobs entstehen. Trumps Quadratur des Kreises – sagenhafte Einnahmen zu generieren und gleichzeitig die ausgelagerten Jobs ins Land zurückzuholen – widerspricht somit der ökonomischen Logik. Und dass es bei den reziproken Zöllen nur in wenigen Fällen überhaupt um Importe geht, die in direkter Konkurrenz mit vorhandenen oder potenziellen amerikanischen Produkten stehen, sollte ohnehin klar sein. Die US-Verbraucher werden auch dann keine amerikanischen Bananen kaufen können, wenn Trump Importe aus Guatemala, Ecuador oder Costa Rica mit 500-Prozent-Strafzöllen belegen würde. Und ob jemals ein „amerikanisches iPhone“ zu einem Preis hergestellt werden kann, der halbwegs marktfähig ist, sei ebenfalls dahingestellt.
Handelsbilanzen haben übrigens immer zwei Seiten. Implizit fordert Trump ja nun andere Staaten auf, mehr amerikanische Produkte zu kaufen. Die Näherin in Lesotho wird sich aber auch dann keinen Ford F150 Pickup leisten können, wenn Lesotho gar keine Zölle erhebt, und inwieweit Einfuhrzölle der USA daran etwas ändern könnten, ist überdies nicht ersichtlich. Im schlimmsten Fall verliert die Näherin ganz einfach ihren Job. US-Exporteuren ist damit kein Jota geholfen. Ob in den USA neue Jobs entstehen können oder alte Jobs zurückkehren, hat ohnehin nur wenig mit Lohnkosten, dafür umso mehr mit Lieferketten und qualifizierten Arbeitnehmern zu tun. Sicher, das sind keine fixen Größen. Doch der dafür nötige „Strukturwandel“ wäre eher eine Frage von Jahrzehnten gezielter Investitionen und lässt sich nicht mit Strafzöllen binnen Wochen über das Knie brechen. Doch auch hier stellt sich die Frage, was man damit überhaupt bezwecken will. Am Ende zahlt der Verbraucher den ganzen Spuk und letztlich steigt dadurch nur der Preis. Die Kaufkraft, vor allem der unteren Schichten, sinkt.
Zölle können durchaus ein sinnvolles politisches Instrument sein. Beispielsweise dann, wenn es darum geht, strategisch wichtige Sektoren im Lande zu halten oder um eine offensichtliche Dumpingstrategie, die ja oft auch im Kontext staatlicher Subventionen steht, zu kontern. Hätten Deutschland oder die EU beispielsweise in den 1990ern und 2000ern konsequent die damals zu Dumpingpreisen angebotenen chinesischen Solarmodule durch Zölle vom Markt gehalten, gäbe es womöglich in Deutschland noch eine Solarindustrie. Diese zielgerichteten und begründeten Zölle haben jedoch wenig bis nichts mit den Pauschalzöllen zu tun, die Trump verkündet hatte.
Warum hat Donald Trump denn dann überhaupt die Weltwirtschaft mit seinen reziproken Zöllen schockiert, wenn er ohnehin bereits vorher ahnen musste, dass diese Zölle in der verabschiedeten Form so nicht standhalten werden? Die Antwort auf diese Frage kann nur heißen, dass die Zölle nie das Ziel, sondern nur ein Mittel zum Zweck waren, andere Ziele zu erreichen. Und genau dabei ist er nun auch auf einem guten Weg. Glaubt man der US-Regierung, finden zurzeit mit 120 Ländern Verhandlungen zu bilateralen Handelsabkommen statt. Auch mit der EU wird nun verhandelt. Am Ende könnten hier beispielsweise die Erhöhung der EU-Energieimporte aus den USA, erhöhte Importe von Waffensystemen und Konzessionen auf dem Gebiet der Regulierung der Tech-Konzerne auf der Agenda stehen. Hätte Trump dies auch erreicht, ohne mit der Zollkeule zu schwingen? Wohl nicht. Ist Trump also genial? Auch das trifft nicht zu. Trump profitiert nur davon, dass die volkswirtschaftlichen Gegner der USA entweder – wie die EU – immer noch gedanklich am Rockzipfel des großen Bruders hängen oder – wie die BRICS-Staaten – untereinander in Konkurrenz stehen und keine gemeinsame Antwort auf die US-Erpressungen finden.
Auch in den bilateralen Verhandlungen mit anderen Staaten und Wirtschaftsräumen haben die USA durchaus gute Chancen, Ergebnisse zu erzielen, die ohne die offene Erpressung mittels Zollandrohungen so nicht erreicht werden könnten. Trump weiß genau, bei internationalen Abkommen sind die USA nur ein Teilnehmer von vielen und können ihre Interessen nur schwer nur gegen den Rest der Welt durchsetzen. Bei bilateralen Abkommen sind die USA jedoch in jeder einzelnen Verhandlung der Stärkere und können ihre Interessen so viel besser erzwingen. Das Recht des Stärken – Imperialismus in Reinkultur.
So gesehen lief der Zollkrieg eigentlich nach Trumps Vorstellungen. Doch dann kam die urplötzliche Wende und er verkündete – wenig glaubhaft – eine Pause der reziproken Zölle, baute seine Drohkulisse also selbst wieder ab. Was war geschehen? Er hat seine Rechnung offenbar ohne die Finanzmärkte gemacht. Dazu muss man zunächst ein wenig in die volkswirtschaftlichen und mehr noch die finanzwirtschaftlichen Hintergründe einsteigen. Die Erklärungen und Erzählungen, die in unseren Medien kursieren, sind dafür nicht sonderlich hilfreich. Hier konzentriert man sich paradoxerweise auf den Aktienmarkt. Während der gesamten Woche nach Trumps Zollankündigungen ging es in der Berichterstattung vornehmlich um den angeblichen „Börsencrash“, den sie ausgelöst hätten. Das allein ist Unfug, zwar hat beispielsweise der für den US-Markt maßgebliche S&P 500 Index in der Tat nach der Verkündung der neuen Zölle kurz gehustet und in den Folgetagen um rund 15 Prozent nachgegeben – er war jedoch im letzten Jahr um mehr als 15 Prozent gestiegen, sodass man dies auch als überfällige Korrektur eines aufgeblähten Marktes bezeichnen könnte. Kein Grund zur Panik, aber mit ruhigen Analysen verliert man im Wettrennen um Auflage, Einschaltquote und Klickzahlen.
Viel spannender als der Aktienmarkt war in dieser Woche der Markt für US-Staatsanleihen – der ansonsten wohl einer der stabilsten der Welt ist. Dass die Börsen volatil sind und es auch mal ordentlich bergab geht, ist vollkommen normal. Ein solcher „Bärenmarkt“ geht jedoch in den allermeisten Fällen mit steigenden Preisen für als sicher geltende Staatsanleihen einher. Fonds, Banken und Versicherungen ziehen Gelder aus dem unruhigen und unsicheren Aktienmarkt ab und parken sie auf dem Anleihenmarkt. Dies ist übrigens ganz im Sinne der Staaten, da zusätzliche Nachfrage nach deren Staatsanleihen die Zinsen drückt. Und dies gilt nicht nur für neue Schulden, sondern auch für alte Schulden, die durch neue Schulden abgelöst werden. Gerade für die USA mit ihren sagenhaften 36,6 Billionen(!) US-Dollar Staatsschulden ist dies eine, wenn nicht die entscheidende Größe. Dazu eine kleine Überschlagrechnung: Wenn die USA ihre kompletten Staatsschulden mit einem Zinssatz von 2 Prozent refinanzieren könnte, müsste sie dafür 732 Milliarden US-Dollar pro Jahr bezahlen. Liegt der Zinssatz aber bei 6 Prozent, sind dies 2.195 Milliarden US-Dollar pro Jahr, was mehr als einem Viertel der Staatseinnahmen entsprechen würde. Dagegen sind die möglichen Einnahmen durch Zölle eine zu vernachlässigende Größe.
Der mächtigste Mann der Welt ist also in seiner Politik auf Gedeih und Verderben dem Anleihenmarkt ausgeliefert. Und hier wird es spannend. Wer ist eigentlich auf dem Anleihenmarkt der dominante Player, der die Kurse bestimmen kann? Gerade kritische und alternative Medien kommen an dieser Stelle sofort auf China zu sprechen, das angeblich der größte Gläubiger der USA sei. Das ist aber falsch. Zum einen baut China seine Dollar-Reserven, die in der Tat zum größten Teil aus US-Staatsanleihen bestehen, ab. Heute ist China mit Beständen von rund 760 Milliarden US-Dollar in US-Staatsanleihen nur noch die Nummer Zwei hinter Japan, das US-Staatsanleihen im Wert von über einer Billion US-Dollar hält. Der größte Einzelgläubiger der USA ist und bleibt jedoch die eigene Notenbank FED, die derzeit Anleihen im Wert von rund 4,2 Billionen US-Dollar in ihren Bilanzen hat.
Was ist nun aber auf dem Anleihenmarkt genau passiert, dass Trump seine Zollpolitik – auch wenn sie eher als Drohkulisse für die nun laufenden Verhandlungen interpretiert werden sollte – bereits nach acht Tagen wieder kassieren musste? Dafür lohnt sich ein Blick auf die Entwicklung des Zinssatzes (Yield) für die 10-jährigen US Treasury Bonds.
Direkt nach der Ankündigung der reziproken Zölle durch Trump am 2. April sank der Zinssatz deutlich. Das war vorauszusehen und an dieser Stelle sei nochmal auf die Wechselwirkung zwischen den Aktien- und dem Anleihenmarkt erinnert. Es wurde offenbar massenhaft Geld aus dem Aktienmarkt in den Anleihenmarkt verschoben. Am 7. September gab es jedoch eine Kehrtwende, plötzlich schoss der Zins ohne erklärbare Gründe in die Höhe – von 3,9 Prozent um ganze 0,5 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent. Das ist für den sonst eher ruhigen Anleihenmarkt in der Tat ein Erdbeben. Was war passiert?
Dazu gibt es in der Berliner Zeitung die interessante Erklärung, China hätte seine Dollarreserven auf den Markt geworfen und so den Markt für US-Staatsanleihen mit dem Ziel aus dem Ruder laufen lassen, Trump zur Rücknahme seiner Zölle zu zwingen. Einige US-Finanzexperten sahen nicht China, sondern Japan in der Rolle des großen Verkäufers, der Trump die Stirn bot. Beide Varianten sind pure Spekulation und unwahrscheinlich. Hätten die Notenbanken dieser beiden Staaten derart massiv Dollar-Papiere auf den Markt geworfen, wäre dies nicht ohne Folgen für den Dollarkurs geblieben. Der Dollar hätte dann gegenüber dem Yuan und/oder dem Yen deutlich abgewertet. Ein Blick auf den Dollar-Kurs zeigt jedoch, dass er an diesen zwei Tagen gegenüber dem Yuan sogar an Wert gewann und gegenüber dem Yen nur leicht an Wert verlor. Es ist also wahrscheinlicher, dass japanische Banken Teile ihrer Treasury-Bonds verkauft haben. Eine große Intervention gab es aber nicht. Wer hat dann aber den Markt derart beeinflusst?
Die Antwort ist recht einfach – es waren US-Banken und US-Fondsgesellschaften, die offenbar im großen Stil US-Staatsanleihen verkauft haben. Die interessantere Frage ist die nach dem „Warum“. Sicher, gemäß der neoliberalen Marktlogik könnte es durchaus sein, dass beispielsweise die Algorithmen von BlackRock Alarm wegen der mit den Zöllen verbundenen Rezessionsgefahr geschlagen haben. BlackRock-Chef Larry Fink äußerte sich in diesen Tagen auch dementsprechend. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass wir es hier mit einer Kraftprobe zu tun hatten. Anders als Teile der Realwirtschaft haben sowohl die Tech- und Netzgiganten aus dem Valley als auch die Finanzgiganten der Wall Street überhaupt kein Interesse an Trumps Zollpolitik, zumal sie befürchten, dass sie – die eigentlichen ökonomischen Großmächte in den USA – am Ende die Leidtragenden eines Handelskriegs sein werden. Also zeigten sie Donald Tump, wer die Macht hat, und dies auf sehr eindrückliche Weise. Kaum verkündete Trump ein Moratorium seiner reziproken Zölle für alle Länder außer China, nahm der wundersame Zinsanstieg am US-Anleihenmarkt wieder ab und die Unruhen auf den anderen Finanzmärkten fanden ebenfalls ihr Ende.
Ist der Handelskrieg und die Gefahr einer weltweiten Rezession damit beendet? Mitnichten! Trump hat China den Handelskrieg erklärt und es sieht zurzeit so aus, als sei er durchaus gewillt, diesen Krieg mit voller Härte zu führen. Für China ist dies keine gute Nachricht, auch wenn man davon ausgehen kann, dass China dieses Szenario nicht unvorbereitet trifft und dass man in Planspielen bereits Lösungen erarbeitet hat. Die Folgen dieser Politik werden aber auch die USA schon bald zeitversetzt treffen. Volkswirtschaftlich ist dabei eher irrelevant, dass die US-Bürger nun keine Technikgimmicks bei Temu mehr kaufen können. Ganz und gar nicht irrelevant ist jedoch das Chaos, das schon bald bei den Lieferketten entstehen wird. Die Verteuerung chinesischer Endprodukte wird vor allem den Verbraucher treffen. Die Verteuerung chinesischer Vorprodukte und Komponenten wird jedoch die US-Wirtschaft treffen, deren Endprodukte dadurch teurer werden und womöglich international weniger wettbewerbsfähig werden. Am Ende könnten die USA so nicht der große Gewinner, sondern der große Verlierer dieses Handelskriegs sein. In diesem Punkt ähneln Handelskriege „echten“ Kriegen – es gibt keine Gewinner.
Titelbild: rawf8/shutterstock.com