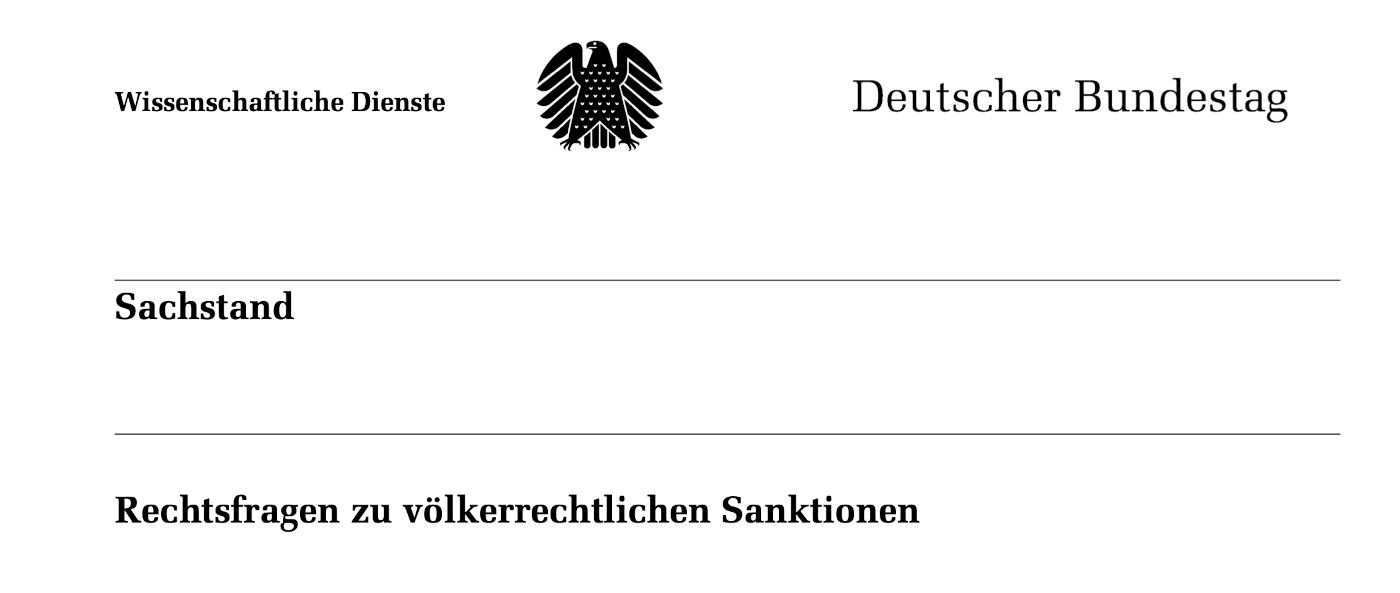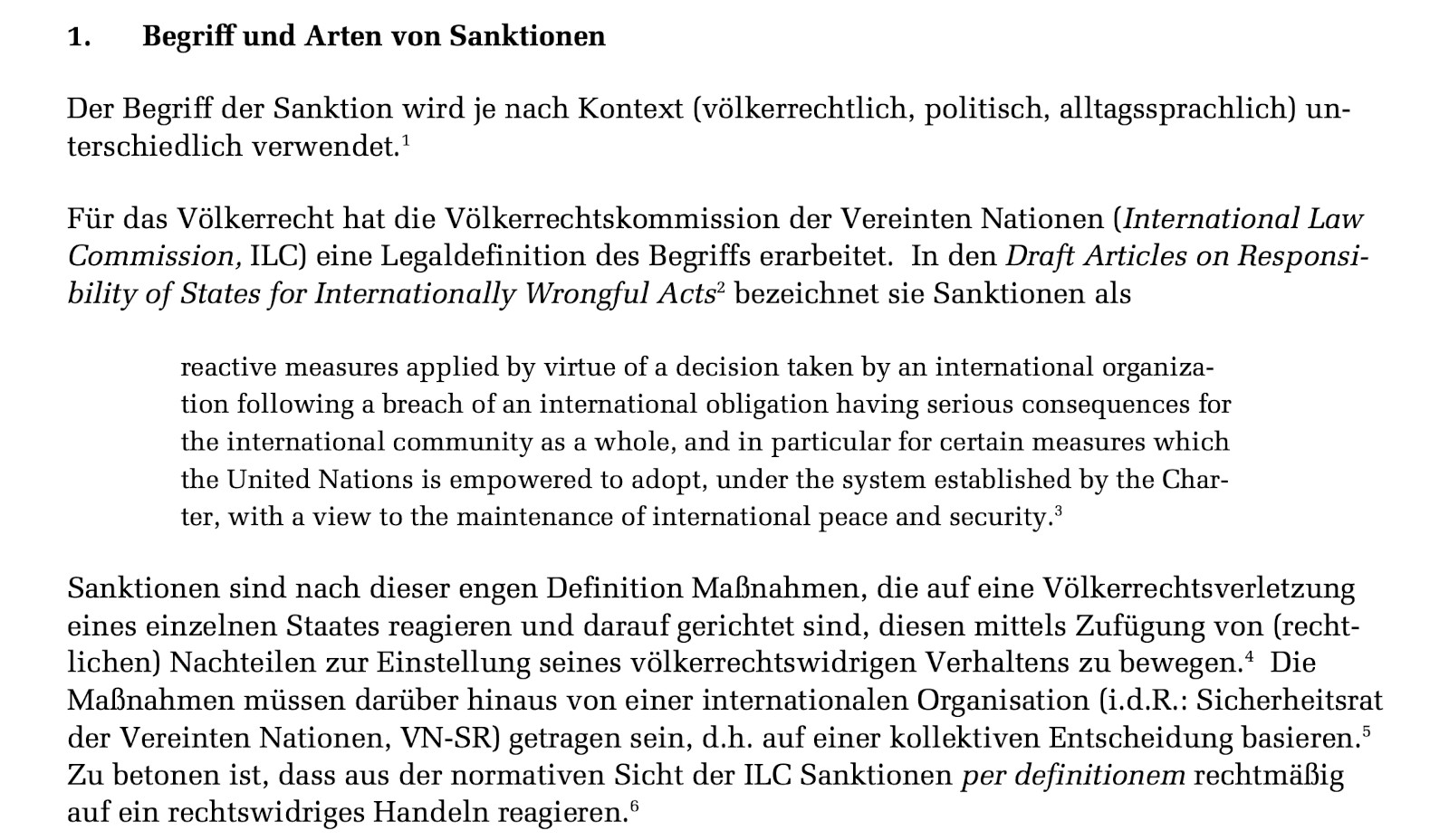Im Zuge der Diskussion um die teilweise Aufhebung von US-Sanktionen gegen Russland kam in der Bundespressekonferenz die Frage auf, wie Deutschland und die EU sich dazu verhalten. Die NachDenkSeiten wollten in diesem Zusammenhang wissen, wie die Bundesregierung die EU-Sanktionen gegen Russland völkerrechtlich bewertet, da die Verhängung dieser Sanktionen ohne Legitimierung durch die Vereinten Nationen erfolgte. Laut Regierungssprecher und Auswärtigem Amt sei dies kein Problem, die EU könne eigenständig Sanktionen verhängen. Doch die Rechtslage ist mitnichten so klar, wie von der Bundesregierung behauptet. Von Florian Warweg.
Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.
Podcast: Play in new window | Download
Hintergrund: Die krachende UN-Abstimmungsniederlage von EU und USA gegen ihr einseitiges Sanktionsregime
Am 3. April 2023 stimmte der UN-Menschenrechtsrat mit überwältigender Mehrheit für eine von der Bewegung der Blockfreien Staaten eingebrachte Resolution, die die Abschaffung von einseitigen Wirtschaftssanktionen, wie sie vornehmlich die USA und die EU anwenden, fordert. Diese „einseitigen Zwangsmaßnahmen“ verstießen gegen die UN-Charta und Grundsätze für friedliche Beziehungen zwischen den Staaten. Lediglich die USA, Großbritannien, die EU-Mitgliedsstaaten sowie Montenegro, Georgien und die Ukraine stimmten gegen die Resolution. Alle Vertreter afrikanischer, asiatischer und lateinamerikanischer Staaten stimmten, bei einer Enthaltung (Mexiko), dafür.
Die Resolution mit dem Dokumentennamen A/HRC/52/L.18 und dem Titel „Die negativen Auswirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen auf die Wahrung der Menschenrechte“ fordert alle Staaten auf, „keine einseitigen Zwangsmaßnahmen mehr zu ergreifen, beizubehalten, durchzuführen oder einzuhalten“, da diese „gegen die Charta der Vereinten Nationen und die Normen und Grundsätze für friedliche Beziehungen zwischen den Staaten verstoßen“.
Zudem zeigten sich die Verfasser „alarmiert über die unverhältnismäßigen und unterschiedslosen menschlichen Kosten einseitiger Sanktionen und ihre negativen Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung, insbesondere auf Frauen und Kinder, in den Zielstaaten“ sowie „zutiefst beunruhigt über die negativen Auswirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen auf das Recht auf Leben, das Recht eines Jeden auf das für ihn erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit und medizinischer Versorgung, das Recht auf Freiheit von Hunger und das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard, auf Nahrung, Bildung, Arbeit und Wohnung sowie das Recht auf Entwicklung und das Recht auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt“.
Die Verfasser der Resolution fügten hinzu, dass Sanktionen zu „schwerwiegenden Verletzungen der Menschenrechte der betroffenen Bevölkerungsgruppen“ führen, mit „besonderen Folgen für (…) ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen“.
Weiter hieß es in dem mit großer Mehrheit angenommenen Resolutionstext:
„(Wir) verurteilen aufs Schärfste die fortgesetzte einseitige Anwendung und Durchsetzung solcher Maßnahmen durch bestimmte Mächte als Druckmittel, einschließlich politischen und wirtschaftlichen Drucks, gegen jedes Land, insbesondere gegen die am wenigsten entwickelten Länder und die Entwicklungsländer, mit dem Ziel, diese Länder daran zu hindern, ihr Recht auszuüben, aus freien Stücken über ihr eigenes politisches, wirtschaftliches und soziales System zu entscheiden.“
Das Gutachten der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages zu völkerrechtlichen Sanktionen
Die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages (WD) veröffentlichten am 8. Juli 2019 einen sogenannten völkerrechtlichen Sachstand mit dem Titel „Rechtsfragen zu völkerrechtlichen Sanktionen“.
Dort heißt es einführend, dass Sanktionen von der Völkerrechtskommission der Vereinten Nationen definiert sind als „reaktive Maßnahmen, die aufgrund eines Beschlusses einer internationalen Organisation nach einer Verletzung einer internationalen Verpflichtung mit schwerwiegenden Folgen für die internationale Gemeinschaft als Ganzes ergriffen werden, und insbesondere bestimmte Maßnahmen, zu deren Ergreifung die Vereinten Nationen im Rahmen des durch die Charta geschaffenen Systems zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit befugt sind“.
Die Befugnis zu Sanktionen wird hier von der UN-Völkerrechtskommission zumindest explizit nur den Vereinten Nationen zugesprochen. Auch die Autoren des Sachstands der WD ergänzen die Definition um die Bemerkung:
„Die Maßnahmen müssen darüber hinaus von einer internationalen Organisation (i.d.R.: Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, VN-SR) getragen sein.“
Der Sachstand verweist im weiteren Verlauf zudem auf die Resolution 34/13 des UN-Menschenrechtsrates von 2017, die zu dem Schluss kommt, „dass einseitige Zwangsmaßnahmen gegen das Völkerrecht, das humanitäre Völkerrecht, die VN-Charta und die Normen und Grundsätze für friedliche Beziehungen zwischen Staaten verstoßen“ (…) und alle Staaten auffordert, „keine einseitigen Zwangsmaßnahmen zu ergreifen und bereits bestehende Sanktionen rückgängig zu machen“.
Resolutionen des UN-Menschenrechtsrates sind formal betrachtet „nur“ Empfehlungen an die UN-Generalversammlung und begründen für sich allein stehend noch keine Rechtspflichten der Staaten, gleichwohl kommt ihnen, das schreiben auch die Völkerrechtler des Bundestages, „ein starker appellatorischer Charakter zu, zumal sie zur Entwicklung von Völkergewohnheitsrecht beitragen (…)“.
Die Haltung der EU
Die EU räumt für sich das Recht ein, auch selbst Sanktionen (sogenannte „autonome Sanktionen“) zu verhängen. Geregelt ist dies in Artikel 29 des Vertrags über die Europäische Union. Durch den erwähnten Artikel 29 wird dem Rat der Europäischen Union die Befugnis übertragen, restriktive Maßnahmen (Sanktionen) gegen Regierungen von Ländern, die nicht in der Europäischen Union (EU) sind, gegen nichtstaatliche Entitäten (zum Beispiel Unternehmen) sowie gegen Personen zu verhängen, um eine Veränderung von deren Politik oder Aktivitäten zu bewirken.
Die EU erlässt Sanktionen laut Artikel 29 als eigene Maßnahmen unter folgenden Bedingungen:
- Wenn nationales Recht oder die Menschenrechte nicht geachtet werden;
- Politiken oder Handlungen durchgeführt werden, die gegen die Rechtsstaatlichkeit oder die demokratischen Grundsätze verstoßen.
Unter „Allgemeiner Rahmen für EU-Sanktionen“ heißt es bei der EU dann aber einschränkend:
- „Bei diesen Sanktionen handelt es sich um vorbeugende und nicht um strafende Instrumente, die es der EU ermöglichen sollen, in Einklang mit den Prinzipien der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik schnell auf politische Herausforderungen und Entwicklungen zu reagieren.“
- „EU-Sanktionen sollten im Rahmen eines umfassenderen politischen Dialogs gesehen werden. Restriktive Maßnahmen sollen die Auswirkungen für die zivile Bevölkerung möglichst gering halten.“
Die Sanktionen gegen Russland haben nachweislich einen „strafenden“ und nicht einen „vorbeugenden“ Charakter und auch die Vorgabe, „EU-Sanktionen sollten im Rahmen eines umfassenderen politischen Dialogs gesehen werden“, sind derzeit nachweislich nicht erfüllt.
Auszug aus dem Wortprotokoll der Regierungspressekonferenz vom 26. März 2025
Frage Dr. Rinke (Reuters)
Ich würde gern noch einmal auf die Sanktionen gegen Russland zurückkommen. Herr Hebestreit, nur um da sicher zu gehen: Russland hat ja Bedingungen gestellt. Unter anderem ist eine Bedingung für diesen zeitweisen Waffenstillstand im Schwarzen Meer, dass eine russische Agrarbank wieder Zugang zu dem internationalen Finanzabwicklungssystem SWIFT erhält. Das wäre eigentlich eine Maßnahme, die nur mit Zustimmung der Europäer und Deutschlands beschlossen werden könnte. Das heißt, diese Forderung wird auf jeden Fall abgelehnt werden. Ist das richtig?
Regierungssprecher Hebestreit
Ich kenne keinerlei Bestrebungen innerhalb Europas, diese Sanktionen aufzuheben.
Frage Warweg
Nur eine grundsätzliche Verständnisfrage, wenn wir gerade bei Sanktionen der EU sind: Generell gelten Sanktionen nur als völkerrechtlich legitimiert, wenn ihnen eine UN-Resolution unterliegt. Entschuldigen Sie meine Ignoranz, aber können Sie mir noch einmal in Erinnerung rufen, auf welcher UN-Resolution die EU-Sanktionen gegen Russland beruhen?
Wagner (AA)
Herr Warweg, das stimmt einfach nicht. Die EU kann natürlich Sanktionen erlassen und tut es auch in verschiedenen Kontexten.
Ich will noch einmal die Gelegenheit nutzen, weil das jetzt in verschiedenen Fragen hier angeklungen ist, etwas klarzustellen: Es geht, wenn man sich das genau anschaut, nicht um Sanktionen gegen russische Getreidelieferungen oder Düngerlieferungen. Diese Sanktionen gibt es ja nicht. Das ist ein russisches Narrativ, dass es solche Sanktionen gibt. Es gibt Maßnahmen, die zum Beispiel Bankabwicklung usw. betreffen.
Wenn Sie sich in Erinnerung rufen, wie das im Schwarzen Meer lief, so ist dort ein Getreidedeal abgeschlossen worden, und die Ukraine hat es geschafft, Getreidelieferungen trotz russischer Angriffe wiederherzustellen. Insofern muss man da sehr genau hinschauen, wie die Abläufe wirklich waren. Aber noch einmal, weil Sie jetzt nach Sanktionen auf Getreide- und Düngerlieferungen gefragt haben: Die gibt es in der Form nicht.
Zusatzfrage Warweg
Herr Wagner, um es nochmals klar zu haben: Sie sagen also, unilaterale Sanktionen, egal von wem verhangen, sind völkerrechtlich legitimiert, auch wenn dem keine UN-Resolution unterliegt?
Wagner (AA)
Die EU erlässt Sanktionen auf Grundlage von EU-Recht.
Hebestreit
Ich darf noch einmal von meinem Proseminar Völkerrecht profitieren und sagen: Es gibt drei Arten von Sanktionen, die die Europäische Union erlassen kann. Das sind UN-Sanktionen, die dann in europäisches Recht umgesetzt werden. Es gibt welche zur Ergänzung von UN-Sanktionen, und es gibt eigenständige Sanktionen. Und der dritte Punkt ist das, was wir gerade diskutieren.
Titelbild: Screenshot NachDenkSeiten, Bundespressekonferenz 26.03.2025