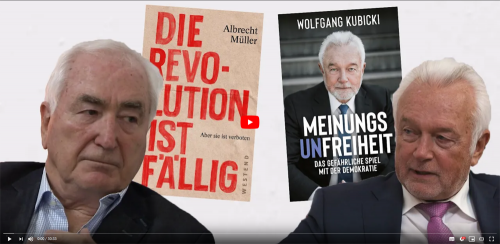Was haben die Techniken von Krimiautoren, die eine spannende Geschichte erzählen wollen und es dem Leser dabei gleichzeitig so schwer wie möglich machen wollen, die Wahrheit herauszufinden, mit PR und Propaganda-Techniken gemeinsam? Auch wenn es auf den ersten Blick erstaunt, gibt es tatsächlich viele Gemeinsamkeiten, sowohl was die Interessenlage, als auch, was die Techniken angeht. In diesem neuen Beitrag aus der Reihe „Propaganda-Taktiken“ werden einige davon genauer beleuchtet. Von Maike Gosch.
„Aber alles passt gut zusammen, wenn man sich nur entscheiden kann, was Realität und was Illusion ist.“- Agatha Christie
Jede Krimi-Leserin kennt wahrscheinlich diesen Aha-Effekt beim Lesen eines klassischen Krimis: Man hat sich durch zweihundert oder mehr Seiten der Geschichte gearbeitet, ist im Dunkeln getappt, hat sich gegruselt, hatte Momente der Erkenntnis, in denen man eins und eins zusammenzählte und das Gefühl hatte, dem Kommissar oder dem Privatdetektiv um eine Nasenlänge voraus zu sein und dann wieder an den eigenen Thesen gezweifelt. Jetzt ist man bei der Auflösungsszene angelangt. Der Detektiv versammelt die beteiligten Personen im Kaminzimmer und rollt noch einmal die ganze Geschichte auf. Er geht nach und nach auf alle falschen Fährten ein, die die Autorin geschickt gelegt hat, und zeigt, warum keine von ihnen den wahren Tatverlauf und die Geschehnisse davor und danach erklären können. Dann kommt der große Moment. Der Detektiv oder Kommissar benennt den Täter und (er-)klärt, wie er den Fall gelöst hat. Und wenn der Krimi handwerklich gut und sauber konstruiert wurde, schlagen wir uns tatsächlich oder innerlich an die Stirn: Warum sind wir da nicht drauf gekommen? Alles deutete doch darauf hin! Wie konnten wir die Hinweise übersehen, die der Detektiv jetzt aufzählt? Warum haben wir sie nicht richtig eingeordnet? Nicht im richtigen Licht gesehen? Schlagartig erkennen wir das Bild. Und fragen uns, warum wir so blind waren.
Dieser Aha-Effekt ist kein Zufall. Und er hat seinen Grund (meistens) auch nicht darin, dass wir einfach zu dumm sind oder unaufmerksam waren. Dieser Aha-Effekt ist das Ergebnis einer sehr sorgfältigen Konstruktion. Die Folge der Kunstfertigkeit, Geschicklichkeit und des Handwerks auf Seiten der Autorin oder des Autors und von ihrer tiefen Kenntnis davon, wie wir Menschen Informationen aufnehmen und verarbeiten. Die Kunst besteht darin, die relevanten Informationen zu geben und Hinweise auf die Wahrheit zu liefern, aber gleichzeitig alles zu tun, damit der Leser sie nicht richtig deutet.
Ein klassischer Krimi besteht daher immer aus zwei Geschichten. Die erste Geschichte ist die Wahrheit. Das, was wirklich passiert ist. Über dieser Wahrheit liegt ein Schleier des Nichtwissens und Nichtverstehens. Als Leser versuchen wir, im Verlauf der Geschichte diesen Schleier zu lüften. Die zweite Geschichte ist der Schleier selbst, seine verschiedenen Teile und all die Theorien und Interpretationen, die wir im Verlauf des Lesens entwickeln. Alle Irrtümer, denen wir aufsitzen, und alle falschen Fährten, denen wir gedanklich folgen. Zusätzlich wird die Wahrheit verdeckt von den Lügen, die von der Wahrheit ablenken sollen und diese verstellen.
In dem Deutschen Kommunikationskodex des Deutschen Rats für Public Relations vom 29. November 2012 heißt es:
„(9) PR- und Kommunikationsfachleute sind der Wahrhaftigkeit verpflichtet, verbreiten wissentlich keine falschen oder irreführenden Informationen oder ungeprüfte Gerüchte.“
Unternehmen, politische und andere Akteure, die professionelle PR betreiben, müssen also darauf achten, dass sie einerseits nicht ausdrücklich „lügen“, sie haben aber dennoch manchmal ein Interesse daran, dass die Bürger die ganze und wahre Geschichte nicht erkennen und verstehen können. Es gibt häufig ein starkes Interesse von verschiedenen Akteuren, diese Wahrheit zu verdecken oder sie zumindest zu verzerren. Manchmal geht es auch darum, nur bestimmte Aspekte kommunizieren zu wollen oder zu müssen, andere aber nicht. Manchmal soll der Fokus gelenkt werden, wie mit einem Scheinwerfer bestimmte Menschen und Themen in helles Licht getaucht werden, andere sollen möglichst im Schatten verschwinden. Die öffentliche Kommunikation ist ganz selten frei von solchen Eigeninteressen der „Erzähler“. Und jede Kommunikation oder Geschichte trifft natürlich auch auf ein starkes Magnetfeld von Interessen, die die Geschichte wiederum für ihre Zwecke verbiegen und verzerren können und manchmal auch wollen.
Dieses Spannungsfeld deckt sich meiner Ansicht nach teilweise mit der Herausforderung des Autors oder der Autorin eines klassischen „whodunnit“ („Wer war der Täter“)-Krimis. Hier wie dort verlangt der Leser/der Bürger, dass er über die Ereignisse ausreichend informiert wird. Hier wie dort hat aber der Autor das Interesse bzw. kann es haben, dass der Leser die Wahrheit über bestimmte Ereignisse und Verhältnisse nicht oder erst später herausfindet. Dennoch muss die Krimiautorin, zumindest nach den Regeln der klassischen Krimistruktur, fairerweise und um das „Miträtseln“ des Lesers zu ermöglichen, alle relevanten Informationen mitteilen. Sie muss also kommunizieren, in der Hoffnung, dass der Leser die „Hidden Story“ nicht oder erst ganz am Ende erkennt und versteht.
Als mir diese Parallele auffiel, habe ich mir die Sekundärliteratur zur Krimitechnik in Hinblick darauf angesehen, welche Methoden der Beeinflussung der Realitäts- und Faktenwahrnehmung in der Öffentlichkeit durch Politik, Journalismus und politische PR mit den Tricks, die Krimiautoren verwenden, vergleichbar sein könnten.[1]
Wir sind alle Detektive
Es gibt noch einen anderen Aspekt, der Parallelen zwischen der Konstruktion von Krimis und der öffentlichen, besonders der politischen Kommunikation bietet: Viele Menschen rezipieren die Informationen durch Presse und andere Quellen immer mehr, als wären sie Leser eines Krimis. Sie sind immer auf der Hut, nicht irregeführt zu werden, besonders in den heute sehr skeptischen „Lügenpresse“-Zeiten. Viele kritische Leser lesen Artikel und rezipieren z.B. die Kommunikation von Politikern oder politischen Parteien ebenso wie die Informationen von Unternehmen auf der Suche nach Lügen, Inkonsistenzen, Interessenverzerrungen, Irreführungen, auf der Suche nach dem cui bono (wem nützt es), nach Fehlern, nach Hinweisen auf die hidden story, auf das, was wirklich passierte. In manchen Fällen ist das ein uninformiertes Misstrauen, eine überzogene Skepsis.
Aber es gibt natürlich tatsächlich viele Geheimnisse, Lügen und Verschleierungen in der öffentlichen Kommunikation sowohl von Regierungen, als auch von Unternehmen. Sie nutzen geschickt die Instrumente des Spins, der emotionalen Manipulation etc., um nur die Informationen rauszugeben, die sie veröffentlichen müssen (aus rechtlichen, politischen oder PR-Gründen), aber dennoch die Rezeption so weit wie möglich zu leiten und zu kontrollieren.
Es wäre sehr nativ, anzunehmen, dass der Öffentlichkeit immer die komplette Wahrheit gesagt würde. Genauso, wie es überzogen ist, anzunehmen, die Öffentlichkeit würde grundsätzlich und durchgängig von Regierung, Unternehmen und der „Lügenpresse“ angelogen.
Methode 1: Jetzt sag’ schon!
Ein Mittel der Verschleierung, aber auch der Spannungserzeugung, sind sogenannte „Unbestimmtheitsstellen“. Das sind Auslassungen in der Geschichte, also das „Nicht-Erzählte“, die Lücken. In einem klassischen Krimi sind das z.B. immer die Identität des Mörders und der genaue Ablauf des Tathergangs.
Unbestimmtheitsstellen in Krimis, aber auch im wahren Leben, lösen in den meisten Menschen kriminalistische Ambitionen aus und den starken Wunsch, das Rätsel zu lösen und damit die Unbestimmtheitsstelle zu schließen. Diesen spannungserzeugenden und Neugier auslösenden Effekt konnte man zum Beispiel gut im Fall der italienischen Schriftstellerin Elena Ferrantes beobachten.[2] Allein die Tatsache, dass die Bestseller-Autorin ihre Identität und ihren Namen geheimhalten wollte, weckte eine so große Neugier, dass die „Aufdeckung“ ihrer Identität und die Details ihrer Person und ihres Lebens, die bekannt wurden – und die denkbar alltäglich und unspektakulär waren –, ein riesiges Presse-Echo erfuhren. Hätte sie diesen Geheimhaltungswunsch nicht gehabt, wäre ihr Privatleben sehr viel weniger interessant gefunden worden. Das soll keine moralische Wertung beinhalten, sondern ist schlicht eine strategische und taktische Analyse. Wenn etwas geheimgehalten wird, gehen Menschen sofort davon aus, dass es interessant ist. Der Wert einer geheimen Information steigt und unsere Neugierde und unser Ehrgeiz werden geweckt.
In der öffentlichen Kommunikation gibt es viele tatsächliche und natürlich auch viele vermeintliche Unbestimmtheitsstellen. Jede offensichtliche „Lücke“ in der Erzählung, sei es in Bezug auf Motive, Täter, Begehungsformen, Hintergründe, Zusammenhänge, löst diese Rätselspannung aus. Schwer zu sagen, warum wir mit Leerstellen, Rätseln, Ungewissheiten und offenen Fragen so schwer umgehen können. Vielleicht können wir es als Menschen einfach nicht lange in einer unerklärten und unerklärlichen Realität aushalten, da wir darin unsere Orientierung verlieren und uns nicht mehr sicher fühlen.
Woran es auch immer liegt, sicher ist, dass nichts Menschen so sehr neugierig macht wie ein Geheimnis. Hier lauert eine Gefahr in der öffentlichen Kommunikation für den Fall, dass eine Information nicht gegeben werden darf oder kann. Die Journalisten und die Menschen werden dann notgedrungen spekulieren und, wie bei einem Krimi, den „Fall“ „lösen“ wollen. Kurz nach einem Ereignis wie einem Terroranschlag oder im Fall von unaufgeklärten Verbrechen müssen wir mit diesen Unbestimmtheitsstellen leben und es ist auch ein Zeichen von Reife, diese Spannung auszuhalten.
Menschen lieben spannende Geschichten, Rätsel und Geheimnisse und sehen dadurch manchmal Verbrechen, Intrigen, Rätsel, Zusammenhänge dort, wo es keine gibt. Das führt dann im Exzess zum Wuchern von Verschwörungstheorien und einem großen Misstrauen gegenüber Politikern, anderen wichtigen Personen des öffentlichen Lebens und Journalisten (Stichwort: „Lügenpresse“ und fake news, s.o.). Wenn die fake news oder die vereinfachten, verzerrenden oder schlicht falschen Geschichten von manchen Politikern oder Agitatoren die spannenderen und dramaturgisch besseren Geschichten liefern, hat die langweilige, banale und unübersichtliche Wirklichkeit ausgedient.
Aber es gibt auch viele Situationen, in denen Menschen einen sehr guten Instinkt beweisen und tatsächliche Unbestimmtheitsstellen und Auslassungen in der Geschichte richtig erkennen. Die Öffentlichkeit „riecht“ richtigerweise, dass etwas an der Geschichte, die man ihr vorsetzt, nicht stimmt. Die Motive sind unplausibel, die Reihenfolge der Ereignisse ist falsch, die Vorgänge passen nicht zu dem Charakter der handelnden Figuren etc. In diesen Fällen ist es gut, dass Bürger und investigative Journalisten keine Ruhe geben, bis bestimmte Zusammenhänge aufgeklärt sind, wie etwa im Fall der Ermordung von John F. Kennedy, dem Tod von Uwe Barschel in einem Genfer Hotel oder den vielen Unstimmigkeiten bei der Aufklärung der Mordreihe durch die NSU.
Methode 2: Ich sehe was, was du nicht siehst
Eine weitere gängige Technik der klassischen Detektivliteratur besteht darin, dem Leser eine lösungsrelevante Information zwar zu vermitteln, sie aber gleichzeitig so zu verbergen, dass er ihre Relevanz nicht erkennt. In Agatha Christies Roman The Sittaford Mystery werden in einer langen Liste die Gegenstände aufgeführt, die im Schrank in der Hütte des Ermordeten gefunden werden, unter anderem zwei Paar Skier. Das zweite Paar Skier benutzte der Mörder, um zu der Hütte zu gelangen und dort den Mord auszuführen. Da er auf Skiern wesentlich früher im Haus sein konnte, als der Ermittler (und der Leser), die ihn zu Fuß wähnen, errechnet haben, verschafft er sich so ein perfektes Alibi. Die Relevanz der Skier, insbesondere der Tatsache, dass es zwei Paar gab, wird aber von dem Leser nicht erkannt, da geschickter Weise noch weitere Sportzubehör-Gegenstände aufgeführt werden, wie Golfschläger, Tennisschläger, Angel-Zubehör, sodass die Skier im Kopf des Lesers in einem unscharfen Sportzubehör-Haufen untergehen. Wir denken nur an ihre Funktion als Sportgerät und nicht an ihre Funktion als reines Fortbewegungsmittel.
Ähnliches geschieht oft in der PR und in der politischen Kommunikation. Informationen können in plain sight versteckt werden, indem sie in einer Menge komplizierter Fachinformation, Fachbegriffen und komplexen Zusammenhängen untergehen. Dies geschieht häufig unfreiwillig, aber manchmal auch vorsätzlich.
In der politischen Kommunikation von Seiten der Regierung wird diese Verschleierungstaktik häufig bei Gesetzgebungsverfahren verwendet, indem z.B. Gesetze zu Gesetzes- und Maßnahmenbündeln verschnürt und ineinander geschachtelt werden wie russische Babuschka-Puppen, bis die einzelnen Maßnahmen und vor allem die gesamte politische Zielrichtung und Strategie dahinter für den Laien und selbst für einen gut informierten Journalisten nicht mehr erkennbar ist. Gute Beispiele hierfür sind die sogenannten Freihandelsverträge TTIP, CETA, TISA etc., in denen Abkommen über die Senkung von Zöllen mit Investitionsschutzvorschriften, stark privatisierungsfördernden Regelungen, Einrichtung von Schiedsgerichtsbarkeitsverfahren und vielen anderen Elementen verzahnt wurden. Ein anderes Beispiel war die Gesetzgebung zur Maut-Erhebung auf deutschen Autobahnen, die Teil eines komplexen Prozesses hin zur Privatisierung der deutschen Fernstraßen-Infrastruktur zu sein schien, was aber nur teilweise offengelegt und erklärt wurde, da den handelnden Politikern der Widerstand der Bevölkerung gegen eine solche Privatisierung bekannt war.
Methode 3: Wie war das noch?
Eine weitere bekannte Taktik von Krimiautoren ist das weiträumige Verstreuen von Fakten. Wichtige Elemente, die zur Lösung beitragen könnten, werden auseinandergenommen und mit großem Abstand voneinander kommuniziert. Wenn die Leserin also den zweiten Teil der Information erhält, hat sie den ersten Teil schon wieder vergessen und kann so die zwei Teile nicht zu einem sinnvollen Zusammenhang verbinden.
In Agatha Christies Roman „The Clocks“ erfährt der Leser von einer Mrs. Bland, die Nachbarin des Hauses ist, in dem ein Mord geschah, dass sie das einzige noch lebende Mitglied ihrer Familie ist. Später äußert dieselbe Frau in einem Gespräch mit Inspektor Hardcastle, dass ihre Schwester am gleichen Ort wohne. Der Abstand von fast vierzig Seiten zwischen diesen beiden Aussagen macht es der Leserin schwer, den offensichtlichen Widerspruch zu erkennen und daraus die Lösung des Krimis zu ermitteln. Denn „Mrs. Bland“ ist tatsächlich eine Hochstaplerin, die die Identität der ersten Ehefrau ihres Mannes annahm, um so an ein großes Erbe zu gelangen, und die den Mord begangen hat, weil ihre falsche Identität aufzufliegen drohte, und die sich in der zweiten Befragung verplapperte.
Dieselbe Methode wird oft angewendet, indem wichtige Informationen zwar mitgeteilt werden, aber diese aus dem Kontext gerissen und zeitlich weit gestreut werden, sodass wir als Bürger den gesamten Sinnzusammenhang nicht erkennen können.
Methode 4: Peng!
„It is, you see, the simple theory of the conjuring trick.
The attention cannot be in two places at once.
To do my conjuring trick, I need the attention focused elsewhere (…).“
(Christie, Three Act Tragedy, 157)
Das ist einer der „easiest and oldest tricks in the bag“: Die Aufmerksamkeit eines Menschen kann nur auf wenige Dinge gleichzeitig gerichtet sein. Um die Aufmerksamkeit von einem Thema oder einem Umstand abzulenken, verwenden Krimiautoren oft und gern einen Knalleffekt. Ein aufregendes Ereignis, das starke Emotionen hervorruft, wie ein Unfall, eine Hochzeit, eine Gefahr etc., wird dazu genutzt, die Aufmerksamkeit von einer anderen wichtigen Situation abzulenken. Der Leser ist abgelenkt und achtet nur noch auf die Entwicklung der Liebesgeschichte oder bangt mit dem Helden wegen einer vermeintlichen Gefahr, passt nicht mehr auf und hört so andere, leisere Töne nicht mehr.
In der politischen Kommunikation wird diese Eigenschaft von Menschen ebenfalls z.B. bei der Verabschiedung unbeliebter Gesetze genutzt, für die die Regierung eine Mehrheit im Parlament hat, von dem sie aber weiß, dass die Bevölkerung mehrheitlich dagegen ist. Diese werden dann zum Beispiel in den Sommerferien oder während der Endrunde der Fußballweltmeisterschaft verabschiedet, um auszunutzen, dass es weniger Zeugen gibt bzw. ein anderes, emotionaleres Ereignis die Aufmerksamkeit der Journalisten und der Öffentlichkeit bindet.
Methode 5: Aber das ist doch viel spannender
Es gibt aber auch noch eine andere Form der Aufmerksamkeitsablenkung, die etwas subtiler ist als der Knalleffekt: Das Legen von „falschen Fährten“. Hier wird die Aufmerksamkeit der Leser nicht durch ein anderes Ereignis abgelenkt, sondern durch eine andere Frage, ein anderes Rätsel, eine andere Aufgabe. Ihre mentale Energie wird umgelenkt auf eine falsche Fährte, um die Aufmerksamkeit und die analytischen Fähigkeiten der Menschen zu „binden“ und sie so von der eigentlich wichtigen Hauptfrage abzulenken.
Ein sehr gutes Beispiel hierfür waren die Reaktionen der NSA, der U.S.-amerikanischen Regierung, der U.S.-amerikanischen und sogar in großen Teilen auch der deutschen Berichterstattung über den NSA-Skandal im Jahr 2013, der durch den US-amerikanischen Whistleblower Edward Snowden enthüllt wurde. Damit die Menschen sich nicht mit der eigentlichen Hauptfrage des Bruchs von Grundrechten, Strafrecht und Völkerrecht durch die Abhörmaßnahmen von Geheimdiensten beschäftigten, wurde die Aufmerksamkeit und das „Knobeln“ geschickt auf die folgenden Rätselfragen gelenkt: „Was sind die technischen Hintergründe, die diese Abhörtechniken erlauben?“, „Wie kann ich meine Geräte vor diesen Abhörtechniken schützen?“, „Wie ist diese Information nach außen geleakt? Wer hatte Zugang zu diesen Informationen und hat sie weitergegeben? War es wieder ein russischer Spion?“. Ich kann es natürlich nicht belegen, aber es scheint der NSA und der U.S.-amerikanischen Regierung auffällig stark in die Karten zu spielen, wenn 90 Prozent der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit sich mit diesen Fragen anstatt mit der Illegalität der Abhörmaßnahmen selbst beschäftigt. Zusätzlich haben die zwei Ablenkungsmanöver noch einen – sicher willkommenen – Spin-Effekt:
Die erste Frage, „Wie kann ich meine Geräte schützen?“, lenkt nicht nur die Aufmerksamkeit von den illegalen Abhörtätigkeiten ab, sondern verschiebt subtil die Situation, sodass der Bürger das Ganze als ein rein technisches Problem betrachtet (und nicht ein politisches), die Abhörmaßnamen werden mehr als eine Naturgewalt wahrgenommen, gegen die man politisch nichts unternehmen kann, sondern sich nur „schützen“ kann wie gegen eine Sturmflut oder einen Stromausfall.
Bei dem sehr starken Fokus auf die zweite Frage, „Wer hat es geleakt?“, ist der Spin-Effekt noch ausgeprägter. Hier wird der Täter zum Opfer (die Nachrichtendienste). Durch das „whodunnit“ (auf Deutsch: „wer war der Täter“)–Framing wird automatisch der Leaker bzw. Whistleblower zum Bösewicht. Wir beschäftigen uns im Rahmen des Framings (Deutungsrahmen) damit, wie ein solcher „Geheimnisverrat“ möglich war, wie die Nachrichtendienste sich davor schützen könnten und wie der Täter identifiziert, gefasst und dann bestraft werden sollte. Sehr leicht gehen Journalisten und die Bevölkerung solchen Framing-Verschiebungen auf den Leim und diskutieren das Thema dann nur noch in den vorgegebenen Leitplanken des neuen Framings.
Methode 6: Guck mal, wer da spricht
Eine letzte klassische Methode, um eine Information oder Botschaft nicht durchdringen zu lassen bzw. zu verhindern, dass ihr Glauben geschenkt wird, ist die Diskreditierung der Quelle. Diese Methode hat gleichzeitig noch den erwünschten Nebeneffekt, dass sich die Öffentlichkeit sehr viel mehr mit dem Charakter, dem Privatleben, im optimalen Fall dem Intimleben der Quelle – Sex ist immer ein guter Aufmerksamkeitsmagnet – beschäftigt als mit der von der Quelle stammenden Information.
Agatha Christie ist auch beim Diskreditieren der Quelle eine Meisterin. In ihrem Roman „A Murder is Announced“ kommen die wichtigsten und besten Hinweise zum tatsächlichen Tatverlauf von Dora Bunner, der Freundin und Haushälterin der Mörderin Miss Blacklock. Dora Bunner wird aber von der Autorin geschickt und über ihr Sprachrohr, den Polizeiinspektor Craddock, als vergesslich, zerstreut, konfus und völlig unzuverlässig charakterisiert. Jede ihrer Aussagen, die helfen könnte, den Tatverlauf zu klären und die Schuld von Miss Blacklock deutlich zu machen, wird dadurch sofort relativiert. Vor allem, weil ihre Vernehmung gemeinsam mit Miss Blacklock stattfindet, die als kompetent, klug und sachlich beschrieben wird und die den Aussagen von Dora Bunner immer sofort widerspricht.
Ein sehr gutes Beispiel für diese Methode in der politischen Kommunikation ist die damalige Berichterstattung über Julian Assange, den Gründer von wikileaks, gegen den weitgehend unfundierte Vergewaltigungsvorwürfe gemacht wurden, was unter anderem dazu diente, die Aufmerksamkeit weg von den durch wikileaks aufgedeckten Kriegsverbrechen der US-Streitkräfte im Irak zu lenken und hin zur detaillierten Beschäftigung mit seinem Sexleben.
Diese Methode, die sehr effektiv ist, wird leider nicht nur von Geheimdiensten und Regierungen angewandt, sondern auch von einigen prominenten PR-Agenturen. Ein besonders bedenkliches Beispiel hierfür ist das Vorgehen von Richard Berman von der PR-Agentur Berman & Company, der nicht umsonst den Spitznamen „Dr. Evil“ trägt: In einem geleakten Vortrag vor Vertretern der Öl- und Gasindustrie im Oktober 2014 bot er an, für seine Kunden rufschädigende und beschämende Informationen über Umweltaktivisten, die gegen die XL-Pipeline in Kanada protestierten, zu recherchieren, um sie damit im öffentlichen Diskurs zu diskreditieren.[3]
Die Auflösung
Diese Überlegungen sollen keine Anleitung zum Lügen sein. Vielmehr sollen sie dabei helfen, zu verstehen, wie die Aufmerksamkeit von Menschen geleitet wird, um darüber aufzuklären, wie Informationen versteckt und verzerrt werden können. Damit alle Akteure in der Kommunikation, die professionellen wie die Laien, diese Methoden erkennen und auf sie reagieren können.
Und falls Sie sich gefragt haben: Anders als es Reinhard Mey 1971 textete, ist der Gärtner in der klassischen Krimiliteratur sehr selten der Mörder. Worauf er wahrscheinlich hinweisen wollte und womit er recht hat, ist, dass der Mörder oft jemand ist, dessen Existenz wir kaum wahrgenommen haben, weil er im Hintergrund verschwand, und dessen Rolle wir falsch gedeutet haben, da wir ihn nur in seiner Funktion als Gärtner gesehen haben und vergessen haben, dass er gleichzeitig noch ein eifersüchtiger Liebhaber, ein rachsüchtiger, trauernder Vater, ein unehelicher Sohn, ein entkommener Sträfling oder Hunderte von anderen Identitäten haben könnte. Wir haben ihn aber nicht verdächtigt, weil der Autor unsere Aufmerksamkeit geschickt so gelenkt hat, dass wir ihn nur in seiner einen Rolle wahrgenommen haben.
Zuerst erschienen in der Zeitschrift politik+kommunikation, aktualisierte Fassung.
Titelbild: Shutterstock / Andrei Porzhezhinskii
„Scripted Reality” – Wie Narrativ-Konstruktionen unser Denken und Handeln bestimmen
Propaganda-Taktiken: Der Primacy-Effekt – oder die Macht des ersten Eindrucks
Wie aus „Zensur“ der „Kampf gegen Desinformation“ wurde: Eine deutsche Geschichte in sechs Schritten
Propaganda und Storytelling: Auf welche Bedrohungen reagieren wir besonders stark?
[«1] Insbesondere: Michael Dunker, „Beeinflussung und Steuerung des Lesers in der englischsprachigen Detektiv- und Krimiliteratur“, 1990 – für eine vertiefte Beschäftigung mit dem Thema sehr zu empfehlen.
[«2] suhrkamp.de/hintergrund/zur-enttarnung-elena-ferrantes-b-3983
[«3] nytimes.com/2014/10/31/us/politics/pr-executives-western-energy-alliance-speech-taped.html?_r=0