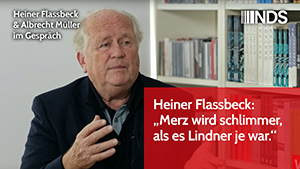Eine Bekannte schreibt mir: „Halte Dich von diesen Rassisten fern!“ Sie meint das BSW, nachdem Sie ein Foto von mir mit Sahra Wagenknecht in den sozialen Medien entdeckt hatte. Dominierte anfangs noch das Attribut „kommunistisch“, vor allem im alten Bundesgebiet, in den ersten Wochen der Entstehungsphase des Bündnisses, wird die neue Partei inzwischen zunehmend von gewissen politischen und medialen Kreisen als „rechts“ definiert. Lesen Sie heute den dritten Teil des Berichts von Ramon Schack. Der erste Teil ist am 8. Juni, der zweite Teil am 12. Juni 2024 auf den NachDenkSeiten erschienen.
Der Politikwissenschaftler und Experte auf dem Gebiet des Rechtsextremismus Hajo Funke äußerte diesbezüglich in einem Interview:
„Ich verstehe schlicht nicht, wie Medien von rechts bzw. von rechtsoffen sprechen können. Das erinnert an die diffamierende Medienkampagne anlässlich der großen Demonstration von Alice Schwarzer und Sahra Wagenknecht vor einem Jahr, als wider besseres Wissen ein Teil der öffentlichen Medien, auch der ARD, die Motive dieser Demonstration als rechtsoffen denunziert haben.“
Ja, die Medien …
Weder „hart noch fair“!
„Wut, Proteste, neue Parteien: Wer hält unser Land noch zusammen?“ lautete der Titel einer Sendung von hart aber fair im Januar dieses Jahres. Eine berechtigte Frage von beklemmender Aktualität, welche aber in der Sendung nicht nur nicht beantwortet oder andiskutiert wurde, sondern lediglich gestreift, um dann gleich wieder die beginnende Diskussion zu ersticken und in andere – möglicherweise genehmere – Bahnen zu lenken.
Zumindest war von der „Orientierung im Wettbewerb verschiedener Ideen“, von dem „Talk auf Augenhöhe “, ja von dem „hartnäckigen Nachfragen“ – mit diesen Worten umschrieb Louis Klamroth seinen Moderationsstil –, nicht einmal als Anspruch, sondern als eine Art Naturgesetz, auf der Homepage der Sendung kaum etwas zu verspüren.
Sicherlich, ein Hauch von Authentizität wurde versprüht, als gleich zu Beginn der 75-minütigen Livesendung eine jener Menschen an den Tisch gebeten wurde, „die im Alltag von den Entscheidungen der Politik betroffen sind“. In diesem Fall handelte es sich um eine sympathisch wirkende Betreiberin eines Frisör-Salons aus Remscheid. Dabei blieb es dann auch, bei diesem Hauch.
Trotz aller Fortschritte in der Kommunikation und im Nachrichtenwesen ist unser Wissen von den anderen, entgegen der allgemeinen herrschenden Meinung, sehr oberflächlich, in vielen Fällen sogar nicht existent. Marshall McLuhan, ein enthusiastischer Verkünder der medialen Revolution, meinte, das Fernsehen mache die Welt zu einem „Globalen Dorf“. Ähnlich optimistisch äußerten sich ja die Pioniere des Internets. Ist diese Metapher aber nicht falsch? Dem Wesen des Dorfes liegt die emotionale und verwandtschaftliche Nähe zugrunde, auch die Enge, die Überschaubarkeit. Leben wir heute nicht eher in einer globalen Metropole, auf einem globalen Bahnhof, durch den die „einsamen Massen“ von David Riesman strömen?
Carsten Schneider (SPD), der Bundesbeauftragte für Ostdeutschland, und der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann saßen der mittelständischen Unternehmerin gegenüber, neben Sahra Wagenknecht als Vorsitzende ihrer brandneuen Partei. Das Ganze erschien rein optisch so, als hätten dort zwei altkluge und strebsame Studenten neben einer Dame Platz genommen, deren Intelligenz und politische Agenda als eine Art Bedrohung wahrgenommen wird, von der man sich aber nicht zu fürchten hat, da Moderator Klamroth ihr regelmäßig und in gewohnter Manier ins Wort gefallen ist, kaum dass die Diskussion in Gang kam.
Carsten und Carsten, die beiden Namensvettern von fast gleichem Alter und einem sehr ähnlichen Habitus, hatten im Gegensatz zu Frau Wagenknecht dann auch die Gelegenheit, sich ausführlich äußern zu dürfen, ohne vom Moderator unterbrochen zu werden. Die These waberte durch das Studio wie das Amen in der Kirche, wonach nur die Regierungsparteien und die Union den Zusammenhalt in der Gesellschaft garantieren würden, komme da, was wolle. Dieser Eindruck wurde verstärkt beziehungsweise sollte verstärkt werden, als drei weitere Gäste aus dem Publikum in die Diskussionsrunde gebeten wurden. Es erschien die Unternehmerin Tijen Onaran, die anscheinend Sahra Wagenknecht die Show stehlen sollte, als sie gleich einer Diva im orange-gelben Hosenanzug ihren Platz einnahm und eloquent dafür plädierte, dass wir eine starke Regierung brauchen und niemanden, der die Regierung permanent kritisiere, wobei sie Sahra Wagenknecht kurz eines Blickes würdigte, der anscheinend so etwas wie Empörung zum Ausdruck bringen sollte.
Der Soziologe Nils Kumkar, Projektleiter am Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt, konnte zumindest in dieser Konstellation nichts Relevantes zum Thema seiner Forschung und der Sendung beitragen, während eine gewisse Maria Fichte, die im sächsischen Freiberg eine „Demo gegen Rechts“ organisiert, auch zu der Erkenntnis gelangt war, dass man doch alles beim Alten lassen sollte, vor allem die politische Macht in den Händen der etablierten Parteien, ,nicht gegen etwas demonstrieren wie Frau Wagenknecht, sondern für etwas‘, wobei sie offen ließ, was dieses „für“ denn sein soll.
Sahra Wagenknecht selbst wirkte bisweilen so, als habe sie es satt, hielt sich auffällig zurück, was aber auch noch eine Folge der Anstrengungen des gerade zurückliegenden Parteitages zu sein schien. Dabei wäre es Wagenknecht gewesen, die der Sendung ein höheres Niveau und eine spritzigere Diskussionskultur verliehen hätte – wenn überhaupt. Der französische Philosoph Grégoire Chamayou analysierte beispielsweise in seinem faszinierenden Buch „Die unregierbare Gesellschaft“:
„Die Strategie zur Überwindung der Regierbarkeitskrise bestand vielmehr in einem autoritären Liberalismus, bei dem die Liberalisierung der Gesellschaft eine Vertikalisierung der Macht impliziert.“
Es ist aber nicht anzunehmen, dass Klamroth zur Vorbereitung seiner Sendung dieses Buch in die Hand genommen hat. Nein, die Sendung verfehlte ihren Anspruch, war weder „hart noch fair“, brachte vor allem keine neuen Erkenntnisse – gar Antworten – auf die Frage, wer denn nun die Gesellschaft zusammenhält. Talkformate wie diese auf jeden Fall nicht.
Zurück in Berlin
Berlin-Karlshorst. In der Havanna-Bar, unweit von Sahra Wagenknechts früherer Wohnung, hat Norman Wolf, der Lichtenberger BSW-Bezirksverordnete, Jutta Matuschek und Judith Benda, die beiden Kandidatinnen für das EU-Parlament, zu einer Veranstaltung geladen. Es ist ein Sonntag im Mai. Besuchern, denen noch das Gesäusel von der angeblichen Rechtslastigkeit des BSW in den Ohren klingt, werden hier eher – wenn auch vereinzelt – mit dem Jargon der untergegangenen SED konfrontiert, etwa, wenn Diskutanten im Rentenalter politökonomische Schulungen fordern oder einen aggressiveren Anti-NATO-Kurs im Wahlkampf.
„Als Benda 13 war, zog sie mit ihren Eltern aus Schöneberg ins brandenburgische Birkenwerder. Erstmals mit Nazis konfrontiert, begann dort ihre politische Sozialisation. Zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Friederike Benda, die auch für die Linke kandidierte, engagiert sie sich gegen Rassismus und rechte Gewalt. Die Arbeit in Initiativen und die Politik auf der Straße ziehen sich durch ihre Biografie. Stark involviert war sie mit der Neuköllner Linken in das erfolgreiche Begehren für ein unbebautes Tempelhofer Feld.“
Das schrieb die taz 2017 über diese Politikerin, deren Schwester heute als stellvertretende Parteivorsitzende fungiert. Auch hier ist ein Rechtsruck schwer zu identifizieren, ebenso wenig wie bei Jutta Matuschek, die im Wahlkampf ihre DDR-Herkunft und ostdeutsche Identität betont.
Am Nebentisch sitzen zwei junge Männer, die miteinander verheiratet sind. Beide stammen aus Russland und engagieren sich für einen Frieden zwischen Moskau und Berlin. Nein, „Putinversteher“ sind es wahrlich nicht, die sukzessive ihre Geschichte erzählen, sondern Menschen, die eventuell Angst haben, zwischen die Fronten zu geraten. Guter Journalismus zeichnet sich durch genaues Hinschauen, durch Grautöne und eben nicht durch Schwarz-Weiß-Bilder aus. Aber diese Grautöne sind selten geworden. Die Tür springt auf. Eine jüngere Frau betritt den Raum – eine Frau, die auf den ersten Blick und oberflächlich betrachtet ein wenig erscheint wie eine dieser Lifestyle-Linken, die Sahra Wagenknecht in einem ihrer Bücher porträtiert und kritisiert hat. Nach einer Viertelstunde meldet sich die Frau in der Diskussion zu Wort. Sie wurde in Serbien geboren, kam in den Nullerjahren nach Deutschland, studierte hier. Die Bundesrepublik – das Land von Marx und Kant – war zunächst ihr Traumland, sie wurde wissenschaftliche Mitarbeiterin einer SPD-Bundestagsabgeordneten. Inzwischen komme ihr Deutschland seltsam vor, wie eine heruntergekommene McDonalds-Filiale, erklärt die Soziologin ihre Beweggründe für die Annäherung an das BSW.
Gastgeber Norman Wolf gelingt es an diesem Vormittag, die höchst unterschiedlichen Auffassungen zu strukturieren, wenn auch nicht alle Diskutanten zufrieden sind. Auch hier bleibt der Eindruck bestehen, der Zuspruch kommt aus allen Richtungen, die Partei ist einem permanenten Erwartungsdruck ausgesetzt, was auch ihre Anziehungskraft zu erklären vermag.
BSW-Hochburg Malchin
Von Berlin in die Provinz. Das Städtchen Malchin liegt inmitten des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte, zwischen Waren und Neubrandenburg. Die Region ist für ihre landschaftliche Schönheit und ihre geringe Bevölkerungsdichte bekannt.
Das Städtchen hat sich zu einer BSW-Hochburg gemausert, nachdem Gerold Lehmann, der bis dahin als Hoffnungsträger der Linkspartei in Malchin galt, Ende letzten Jahres sein Parteibuch abgab und dem Bündnis Sahra Wagenknecht beitrat.
„Ausgerechnet Lehmann, der in der Malchiner Stadtvertretung (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) Fraktionsvorsitzender der Linken ist. Das werde er vorerst auch bleiben, so habe es die Fraktion einstimmig beschlossen, berichtete der 52-Jährige am Mittwoch.
Linke Kommunalpolitik ist weiterhin das Ziel
Seine Sympathien liegen mittlerweile offenbar mehr beim Bündnis Sahra Wagenknecht, das im Januar auf Bundesebene eine neue Partei gründen will. Ob er dort seine neue politische Heimat findet, wolle er aber erst nach der Gründung der Partei und anhand deren Programm entscheiden.
„Auf jeden Fall will ich weiter linke Kommunalpolitik in Malchin machen“, sagt Lehmann und zitiert den Sänger Tino Eisbrenner mit den Worten: „Jetzt gibt es zwei linke Parteien, also eine Verdopplung. Lasst euch nicht zu Feinden machen.“ Zumindest auf kommunaler Ebene wären die neue Partei BSW und die Linken gut beraten, zusammenzuarbeiten, meint Lehmann.“
Das schrieb damals der Nordkurier.
Inzwischen, ein halbes Jahr später, empfängt Lehmann im Parteibüro in der Malchiner Innenstadt. Zusammen mit einigen Weggefährten und Kandidaten für die Kommunalwahlen, die hier am gleichen Tag wie die Europawahlen stattfinden, spricht Lehmann über den Wahlkampf. Der 53-jährige Maler und Lackierer ist im Ort bekannt und beliebt. Eigentlich ist er ein Traumkandidat für eine linke Partei in der Provinz: bodenständig, im Ort vernetzt, ein Arbeiter mit Bildungshunger, jemand, der Menschen für seine Überzeugungen zu gewinnen versteht, der ihre Sprache spricht.

Der BSW-Kandidat Gerold Lehmann in Malchin – Quelle: Ramon Schack
Fortsetzung folgt …
Titelbild: Shutterstock / Gorloff-KV
Wagenknechts Wagnis – Eine teilnehmende Beobachtung zur Entstehungsgeschichte des BSW, Teil 1
Wagenknechts Wagnis – Eine teilnehmende Beobachtung zur Entstehungsgeschichte des BSW, Teil 2
Lex Wagenknecht – die Öffentlich-Rechtlichen sperren das BSW aus
Wagenknecht: Aufarbeitung der Corona-Politik ist ein ganz wichtiges Thema unserer neuen Partei