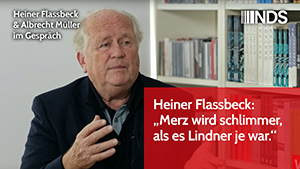Der Bundeswirtschaftsminister will das deutsche Lieferkettengesetz zwei Jahre ruhen lassen, bis das noch schwächere Pendant auf europäischer Ebene in Kraft tritt. Das gefällt dem Unternehmerlager und der FDP, die das EU-Regelwerk vollends verhindern wollte. Merke: Im Kampf gegen die Bürokratie marschieren Grüne und Liberale Seit’ an Seit’, selbst wenn’s Kindlein aus der Kobaltmine schreit. Ein Schmähstück von Ralf Wurzbacher.
Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.
Podcast: Play in new window | Download
Die Bündnis-Grünen haben schon allerhand geliefert: Waffen für die Ukraine, US-Frackinggas, Milliardenhilfen für milliardenschwere Tech-Giganten und vieles mehr, was der Zeitgeist gerade mal so verlangt und Profiteuren die Taschen füllt. Immer tun sie derlei mit Kopfschmerzen, Bauchdrücken und gequälter Miene, aber sie tun es, weil Realpolitik keine Rücksichten und Roten Linien kennen darf und die schlimmen Umstände und die Bösen dieser Welt sich um die Grundsätze ökopazifistischer Gutmenschen einen Dreck scheren. So wird Krötenschlucken zur Dauerbeschäftigung und Prinzipientreue ein No-Go. Die Grünen standen mal für Frieden, jetzt für Krieg. Sie wollten mal das Klima retten, jetzt retten sie Renditen von Ölmultis. Früher bildeten sie die Speerspitze des Widerstands gegen Stuttgart 21, heute sind sie politischer Verwalter des Megadebakels. Die Liste ließe sich lange fortsetzen, aber die Lektion ist immer die gleiche: Kommt es hart auf hart, opfert ein echter Grüner sich selbst und und sein Seelenheil – für die gute Sache.
Robert Habeck ist so ein echter Grüner. Überliefert ist vom amtierenden Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz dieser Satz: „Wirtschaftliches Handeln muss im Einklang mit Menschenrechten stehen und nachhaltig sein. Hierfür ist das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz wichtig.“ Gesagt hat er dies zum Jahresende 2022, zwei Tage vor Inkrafttreten des deutschen Lieferkettengesetzes. Für dessen Zustandekommen hatten die Grünen heftig gerungen, vor allem, als sie noch die Oppositionsbank drückten. Das fragliche Regelwerk stammt eigentlich von der Großen Koalition, allerdings mit der Maßgabe, es erst zum 1. Januar 2023 zur Wirkung zu bringen. Es war und ist also das vornehme Recht der Ampel und ihres grünen Wirtschaftsministers, es „unverändert“ beziehungsweise „gegebenenfalls verbessert“ umzusetzen, wie es im Koalitionsvertrag heißt.
Blutverklebte Profite
Nun ja, irgendwie hat sich der Wind wieder gedreht und damit das Fähnchen im Wind des vom Sturm der Weltpolitik umtosten Grünen-Kapitäns. Weil es die deutsche Wirtschaft gerade so schwer hat – Stichworte: Energiepreisschock, Sanktionspolitik gegen Russland, fehlende öffentliche Investitionen – und die Ampel für all das nun aber auch gar nichts kann, will er das nationale Lieferkettengesetz quasi als kleines Trostpflaster für zwei Jahre einfach mal auf Eis legen. Geäußert hat er dies am vergangenen Freitag beim Tag des Familienunternehmens in Berlin. Dabei verwies er auf die erst in 24 Monaten sukzessive in Kraft tretenden Bestimmungen des kürzlich beschlossenen EU-Lieferkettengesetzes und bemerkte zur vorgeschlagenen Pause: „Das wäre das Beste. Ich halte das für absolut vertretbar.“ Aber weil er wohl ahnte, dass seine Idee in der eigenen Partei und bei der mitregierenden SPD nicht gut ankommen und es noch einige Überzeugungsarbeit brauchen dürfte , setzte er hinzu: „Ich bitte um zwei, drei Wochen Geduld.“
Das wird reichen, so wie auch die Begründung reichen müsste, mit der Habeck seinen Vorstoß versah, nämlich mit der erdrückenden Bürokratie, unter der deutsche Firmen zu ächzen hätten. Insofern wäre der Schritt in seinen Worten ein „richtiger Befreiungsschlag“. Worum geht es beim Lieferkettengesetz? Um Vorkehrungen durch Unternehmen, dass entlang ihrer Wertschöpfungs- und Lieferketten Menschen nicht ausgebeutet, nicht gequält, nicht versklavt, nicht physisch und psychisch kaputtgemacht, nicht entrechtet werden und ihr Leben und Überleben nicht durch exzessiven Raubbau an der Natur infrage gestellt werden. Und darum, dass Leidtragende bei Zuwiderhandlung die Möglichkeit haben, gegen Verstöße vor Gericht zu klagen und Schadensersatzansprüche durchzusetzen. Letztlich geht es darum, sicherzustellen, dass an Waren und Dienstleistungen, mit denen der reiche Westen seine Profite macht, nicht das Blut und der Angstschweiß der Armen und Ausgebeuteten aus den Elendsvierteln dieser Erde kleben.
Tablet made by Kinderhand
Entsprechende Auflagen für Unternehmer kann man als das Allermindeste erachten, um der verbreiteten Not in den Postkolonien der kapitalistischen Hochburgen wenigstens in Ansätzen beizukommen. Oder man nennt sie eine bürokratische Überlast und hängt sie an den Nagel, wie Habeck das will. Aber hat er nicht recht, wenn man das Große und Ganze im Auge behält? Buddeln zehntausende Kinderhände weiter unbehelligt in den Kobaltminen im Kongo, lassen sich noch mehr Smartphones produzieren, die eines schönen Tages vielleicht sogar für die kleinen Kinderarbeiter erschwinglich sind. Mehren wir im Westen unseren Wohlstand, dann profitieren davon doch auch die Menschen in Indien oder in Afrika, wo zum Beispiel die großen Kleiderlabels ihre billigen Klamotten nähen lassen durch Näherinnen, die für zwölf Stunden Schuften einen Dollar verdienen. Die Welt mag manchmal ungerecht sein, aber es wird besser, wenn man Angebot und Nachfrage nicht zu viel Bürokratiegerümpel zwischen die Beine wirft. Oder wer erinnert sich noch an die Brandkatastrophe in der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch vor elf Jahren, bei der mehr als 1.100 Arbeiterinnen und Arbeiter jämmerlich verbrannten? Danach passierte nichts mehr dergleichen, also in dieser Größenordnung und für alle Welt sichtbar. So hat der Skandal am Ende doch Gutes bewirkt, allein durch die freiwillige Selbstverpflichtung der Erzeuger, neuerliche Skandale zu scheuen.
Denkt so ein Herr Habeck? Vielleicht. Vielleicht denkt er auch gar nicht oder einfach nur pragmatisch. Jedenfalls ist das deutsche Lieferkettengesetz ja nun auch nicht das Gelbe vom Ei. Es galt zunächst nur für Firmen ab 3.000 Beschäftigten, seit Januar 2024 dann auch für solche ab 1.000 Mitarbeitern. Damit betraf es anfangs kümmerliche 600 Unternehmen, nun sind es höchstens 4.500. Nach den Vorgaben sind sie dazu angehalten, ihrer Verantwortung in der Lieferkette in Bezug auf die Achtung international anerkannter Menschenrechte und bestimmter Umweltstandards nachzukommen. Allerdings hat das Gesetz eine „lange Leine“, bietet viel Interpretationsspielraum und allerhand Schlupflöcher. So sind etwa bei den umweltbezogenen Pflichten die Biodiversität und Auswirkungen aufs Klima gar nicht berücksichtigt. Die Initiative Lieferkettengesetz hegte deshalb auch einmal die Hoffnung, die Ampel möge das Regelwerk nachbessern und sich auf EU-Ebene für ein Lieferkettengesetz einsetzen, „das die noch vorhandenen Schwachstellen behebt“.
Kein Herz für Mopsfledermäuse
Daraus wurde bekanntlich nichts. Ganz im Gegenteil. Die Bundesregierung ließ das Projekt durch Enthaltung im EU-Rat sogar beinahe scheitern. Schuld war die FDP, die wie immer die Flagge der deutschen Unternehmerschaft hochhalten musste. Das fand auch Robert Habeck ganz unanständig, und demonstrativ groß war seine Genugtuung, als sich am Ende doch noch eine Mehrheit zusammenraufte und die Richtlinie verabschiedete. Schade bloß, dass in dem ganzen Hickhack das anfangs durchaus fortschrittliche EU-Regelwerk komplett entzahnt wurde und es sogar noch hinter die windelweichen Klauseln des deutschen Pendants zurückfällt. Es greift erst bei einer Beschäftigtenzahl ab 1.000, ursprünglich sollten es 500 sein. Und das auch nur ab einer Umsatzschwelle von 450 Millionen Euro jährlich, im Original standen noch 150 Millionen Euro. Überdies hat es in den ersten drei Jahren nach Inkrafttreten nur Geltung für Konzerne mit 5.000 Beschäftigten und wirklich vollumfänglich wirksam wird es 2032.
Beim Verwässern hatte natürlich auch Deutschland seine Finger im Spiel, gewiss auch der grüne Wirtschaftsminister. Umso verständlicher erscheint nun sein Ansinnen, das deutsche Vorpreschen der schlimmen Bürokratie wegen zu stoppen und abzuwarten, bis der europäische Papiertiger sich die kaum vorhandenen Zähne ausbeißt. Denn wer wollte es hiesigen Firmenbossen zumuten, weitere zwei Jahre über mögliche Menschenrechtsverletzungen zu wachen, die dann plötzlich nicht mehr überwachungspflichtig sind und damit wieder piepegal. Schätzungsweise werden unter EU-Ägide maximal noch 1.500 deutsche Großunternehmen oder Konzerne dem EU-Lieferkettengesetz unterliegen und das endgültig erst in acht Jahren. Bis dahin fließt noch so viel Wasser den Rhein hinunter – und reichlich Blut, Schweiß und Tränen in die Sickergruben der Slums in Asien, Afrika und Südamerika. Es gab Zeiten, da hatten die Grünen noch ein Herz für Mopsfledermäuse. Hat sich irgendwie wegregiert …
Titelbild: Heide Pinkall / Shutterstock