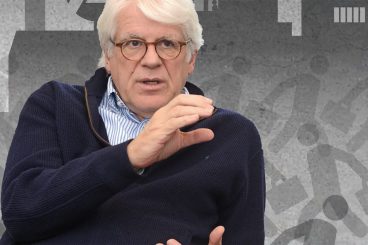In drei Wochen wird das Europaparlament gewählt. Allen Sonntagsreden zum Trotz hält sich die Begeisterung der Wähler europaweit in Grenzen. Das ist verständlich, hat die EU doch nach wie vor enorme Demokratiedefizite, und große Veränderungen sind durch die Wahlen – egal wie sie ausgehen – ohnehin nicht zu erwarten. Der Wirtschaftswissenschaftler Heinz-Josef Bontrup hat die demokratische Verfassung der EU analysiert und kommt dabei zu einem ernüchternden Ergebnis.
Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.
Podcast: Play in new window | Download
Bei Gründung der Europäischen Gemeinschaften stand der Frieden Pate
Nach 17 Millionen Toten im Ersten Weltkrieg und 50 Millionen Toten im Zweiten Weltkrieg entstand innerhalb und zwischen vielen europäischen Staaten der Wunsch nach einer nachhaltigen Friedenssicherung durch die Gründung einer Europäischen Gemeinschaft. „Nie wieder Krieg“ hieß die Botschaft. Der Plan einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (sog. „Montan-Union“) war 1951 die Geburtsstunde der heutigen Europäischen Union (EU). „Durch den Zusammenschluß ihrer Grundindustrien und Errichtung einer neuen überstaatlichen Autorität, deren Beschlüsse bindend sein werden für Frankreich, Deutschland und die übrigen teilnehmenden Länder, werden die ersten Grundlagen einer europäischen Föderation gelegt, die der Erhaltung des Friedens dient“, so der damalige französische Außenminister Robert Schuman (1886-1963) und spätere Präsident der Europäischen Union am 9. Mai 1950. 2012 erhielt die EU, nicht unumstritten, den Friedensnobelpreis für ihre Stabilisierung des Friedens in Europa. Krieg war aber in Europa längst mit dem Jugoslawienkrieg (1991-2001) zurückgekehrt und tobt jetzt, seit 2014, zwischen Russland und der Ukraine mit massiver militärischer Unterstützung der Ukraine durch die USA und die EU; hier insbesondere durch das Mitgliedsland Deutschland. Der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages stellt diesbezüglich eine Kriegsbeteiligung Deutschlands fest. Die Bundesregierung widerspricht. Nur die Linke im Parlament nimmt das Gutachten ernst.
Der Psychologe und Publizist Georg Rammer schreibt in Ossietzky:
„Deutschland und die EU befinden sich im Umbau zu einer repressiven militarisierten Formaldemokratie. Die Reaktion der Bevölkerung schwankt zwischen Aufbegehren und Resignation und der Amnesie der Grünen, die einst systemkritisch das Gegenteil ihres verrohten Bellizismus vertraten. (…) Die den Frieden durch Diplomatie erreichen wollen, kommen um das mühsame Geschäft des differenzierten Argumentierens nicht herum. Kontext herstellen, Hintergründe erläutern, Fragen stellen: Wie viele Kriege hat der Westen in den letzten dreißig Jahren geführt – wie viele der ‚Imperialist Putin‘? Warum hat die Nato in den Jahren vor dem Ukrainekrieg dutzende Manöver an der Grenze Russlands durchgeführt? Hat der Generalbundesanwalt jemals wegen US-Kriegsverbrechen ermittelt, die deutsche Regierung Sanktionen gefordert? Wofür büßt der Journalist Assange seit Jahren im Hochsicherheitsknast? Wie viele UN-Resolutionen hat Israel missachtet? Wollen israelische Parteien gleiche Rechte und einen eigenen Staat für Palästinenser? So viele Fragen: Sich der Echokammer der Bellizisten verweigern, der Amnesie die Erinnerung entgegensetzen.“
Das brauchen wir an Bewusstsein in allen 27 EU-Staaten. Aber von dem europäischen Wunsch nach immerwährendem Frieden sind wir offensichtlich weit entfernt, wenn man Politiker reden hört und Leitmedien über Krieg schreiben, als wäre Krieg etwas Normales, das man ertragen muss. Krieg benötigt zur Vorbereitung immer ein Feindbild, dass in den Völkern nur über eine entsprechende Propaganda geschaffen werden kann. Auch das faschistische Deutschland musste erst von Hitler und seinen Vasallen geschaffen werden, bis „ganz gewöhnliche Deutsche Hitlers willige Vollstrecker“ (Daniel Jonah Goldhagen) wurden. In diesem Kontext hat auch die seit 1917 betriebene Hetze gegen Russland nie aufgehört, auch nicht nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1989. Es war immer ein ökonomischer Krieg, verbunden mit riesigen konventionellen und atomaren Aufrüstungen zwischen den bestehenden Wirtschaftsordnungen, zwischen Kapitalismus und Sozialismus, und der Krieg hat im Grunde bis heute nicht aufgehört. Gegen das primitive Feindbild führte der ehemalige Bundespräsident Gustav Heinemann aus:
„Wir müssen erkennen, daß die antisowjetische Hetze den Vorspann für die westliche Rüstungspolitik darstellt. Wenn wir den Frieden sichern wollen, müssen wir der antisowjetischen Hetze ebenso wehren wie der Hetze gegen irgendein westliches Volk, muß eine Bresche geschlagen werden in den blinden und pauschalen Antikommunismus, diese kriegsträchtige Mentalität bürgerlich-pharisäischer Selbstgerechtigkeit. Wir können mit den östlichen Nachbarn nicht in Frieden leben, wenn wir ihr politisches System auszuhöhlen und zum Zusammenbruch zu führen trachten. Wir haben gegen die Propaganda, welche die psychologische Bereitschaft zum Krieg schaffen soll, ebenso Widerstand zu leisten wie gegen die militärische Kriegsvorbereitung.“
Diese bringt den Rüstungskapitalisten, wie schon immer, enorme Profite: Das größte deutsche Rüstungsunternehmen „Rheinmetall eilt von Rekord zu Rekord“, titelt die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ). Für Journalistinnen wie Eva Quadbeck ist das der „Preis für Sicherheit“. In einem Leitartikel der Frankfurter Rundschau schreibt sie: „Wenn sich der Finanzminister dagegenstemmt, für Subventionen und für zusätzliche Sozialausgaben Schulden aufzunehmen, dann ist das absolut nachvollziehbar. An der Sicherheit der Nation sollte man aber nicht sparen. Russland hat längst auf Kriegswirtschaft umgestellt und ordnet dem eigenen Imperialismus alles unter. (…) Die Schuldenbremse ist eine gute Einrichtung, um die Konsumausgaben des Staates unter Kontrolle zu halten. Wenn sie aber für die Sicherheit des Landes zur Bremse wird, muss sie reformiert werden.“
Wahl zum EU-Parlament
Am 9. Juni sind jetzt Wahlen zum zehnten EU-Parlament (EP). 1979 erfolgte die erste Wahl. Rund 350 Millionen Menschen sind in 27 EU-Staaten – nach dem 2020 vollzogenen Austritt Großbritanniens („Brexit“) – aufgerufen, 720 neue Abgeordnete zu wählen, davon 96 deutsche Parlamentarier. In Deutschland dürfen erstmals auch 16- und 17-Jährige abstimmen. Die Wahl findet vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine und vor einer in der EU massiv vorliegenden politischen Rechtsorientierung statt, die ihre wesentliche Ursache in einer zwischen den EU-Staaten und auch innerhalb der Länder sich immer mehr entwickelten wirtschaftlichen Segmentierung und Spaltung hat. Der von der EU-Politik und ihren Staaten initiierte und damit gewollte wirtschaftliche Kurs einer neoliberalen Marktradikalität hat den Reichtum bei wenigen konzentriert und die Armutsquoten steigen lassen. Die Wirtschafts- und Währungsunion, beschlossen im Maastricht-Vertrag am 7. Februar 1992, war und ist kein Wohlfahrtsplan für die Mehrheit der Menschen in den EU-Staaten, sondern für eine kapitalbesitzende Minderheit. Und die EU ist für die Bürger und Bürgerinnen eine völlig intransparente Institution, in der nicht einmal die Entscheidungen der EU-Politiker, wie wir im Folgenden sehen werden, auf Basis einer indirekten (parlamentarischen) Demokratie getroffen werden. Das EU-Volk ist zugleich meilenweit von einer politischen Willensbildung entfernt bzw. wird nicht einmal in Ansätzen beteiligt, sondern permanent vor vollendete Tatsachen gestellt.
Selbst die Auslösung eines Krieges würde hier heute ohne Volksabstimmungen von törichten Politikern vollzogen. Hier kann ich dann allen nur das Buch der US-amerikanischen Historikerin Barbara Tuchman „Die Torheit der Regierenden. Von Troja bis Vietnam“ empfehlen.
Das EU-Parlament hat nur wenig zu sagen
Das EP spielt im gesamten EU-Gefüge, wenn überhaupt, nur eine sekundäre Rolle und das EP, wo eine Politik für alle Menschen in der EU gemacht werden müsste, ist gar kein richtiges Parlament und noch weiter von den Interessen und Nöten der Menschen entfernt, als dies in den Nationalparlamenten schon der Fall ist. Ein richtiges Parlament hat im Rahmen der staatlichen Gewaltenteilung uneingeschränkt die Legislative zu sein. Hier werden die Gesetze gemacht. Das trifft für das EP aber nicht zu. Die EU ist kein Staat, sondern nur eine Staatengemeinschaft. Andreas Fisahn, Professor für öffentliches Recht an der Universität Bielefeld, schreibt:
„Das EP ist legislatives Organ, aber nur mit einer zweiten Kammer auf nationaler Ebene vergleichbar. Das Parlament muss nämlich keineswegs allen Rechtsakten der EU zustimmen. Bei einigen Rechtsakten muss das Parlament nur angehört werden. Wann es nur angehört, wann es zustimmen muss, regelt das Primärrecht für jeden Politikbereich speziell, es gibt also keine allgemeine Regel.“
Hinzu kommt, dass es in der EU kein einheitliches Wahlrecht gibt. Jedes EU-Mitgliedsland wählt die Abgeordneten nach nationalem Recht, und es werden die Parteien der einzelnen Länder und keine europäischen Parteien gewählt; die gibt es nämlich nicht.
So ist es eine logische Folge, dass die Menschen in den EU-Staaten nur über die Politik ihrer Länder abstimmen und der ganze „Wahlkrampf“ auch nur auf nationaler und nicht auf europäischer Bühne stattfindet.
Keine EU-Verfassung
Weiter gilt, dass das EP auf keiner Verfassung beruht, sondern lediglich auf einem EU-Vertrag, der am 1. Dezember 2009 in Kraft trat, und einem Vertrag über die „Arbeitsweise der Europäischen Union“ (AEUV). Eine EU-Verfassung scheiterte 2005 an Frankreich und den Niederlanden. Irland stimmte erst im zweiten Anlauf zu. Und 1993 votierte in einer Volksabstimmung Dänemark gegen die Einführung des Euros. In Deutschland fanden dagegen weder bezüglich der EU-Verfassung noch bezüglich der Euro-Einführung Volksabstimmungen statt. Hier entschied jeweils nur der Bundestag und Bundesrat indirekt. Mit dem Scheitern der Verfassung schien die EU politisch tot zu sein. Das wurde aber von der herrschenden politischen Elite in der EU nicht akzeptiert.
Ohne die Völker in einer weiteren Volksabstimmung zu fragen, wurde dann ganz einfach die geplante Verfassung, nur ohne offizielle Fahne und Hymne, in einen EU-Vertrag umgewandelt und danach die AEUV, auch ohne jegliche demokratische Abstimmung, in den Hinterzimmern der politischen Macht, ex-post hinzugefügt. Jörg Huffschmid, der sich wie kein anderer Ökonom mit dem wirtschaftlichen Part der Verfassung auseinandergesetzt hat, kam 2004 zu einem vernichtenden Urteil:
„Diese Verfassung wird die Europäische Union ihren Bürgern und Bürgerinnen nicht näherbringen. Sie wird den Prozess der Entfremdung festschreiben, (…). Auch die angekündigte Demokratisierung europäischer Strukturen und Verfahren durch die Verfassung ist im Wesentlichen ausgeblieben. Vielmehr würde bei Verabschiedung des Entwurfs die Demontage sozialstaatlicher Substanz durch die neoliberalen Gegenreformen Verfassungsrang erhalten, (…).“
Europäischer Rat und Ministerrat
Viel bedeutender als das EP sind der Europäische Rat und der Ministerrat. Schon 1974 wurde der Europäische Rat, besetzt mit den Regierungschefs der EU-Länder, ins Leben gerufen. Er legt die Leitlinien für die Entwicklung der EU und für die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik fest – und nicht das Europäische Parlament. Außerdem ernennt der Rat die EU-Kommissionsmitglieder, die dann vom Europäischen Parlament lediglich noch bestätigt werden müssen. Auch die Richter am Europäischen Gerichtshof (EuGH) sowie den Präsidenten der Europäischen Zentralbank bestimmt der Rat.
Vom Europäischen Rat zu unterscheiden ist der Ministerrat, das zentrale operative Entscheidungsgremium der EU. Jeder der Mitgliedsstaaten darf hier ein Mitglied, das im Heimatland den Status eines Ministers haben muss, in den Ministerrat entsenden. Der Vorsitz ist durch ein Rotationsprinzip bestimmt. Er wechselt halbjährig am 1. Januar und am 1. Juli. Zu den Aufgaben des Ministerrates zählen die Rechtsetzungsbefugnis, das Initiativrecht, Kontrollrechte, Koordination der Wirtschaftspolitik, Abschluss von Abkommen mit dritten Staaten und internationalen Organisationen, Ernennung der Mitglieder des Wirtschafts- und Sozialausschusses, des Regionalausschusses und des Rechnungshofes, Festsetzung von Gehältern und die Aufstellung des Entwurfes für einen Haushaltsplan. Hier zeigt sich die hohe, nicht wirklich demokratisch zu kontrollierende Machtfülle des Ministerrats. Die Entscheidungen werden alle hinter verschlossenen Türen getroffen und sind von den Sorgen und Nöten der EU-Bewohner ganz weit entfernt. Beschlüsse kommen grundsätzlich mit einfacher oder doppelt qualifizierter Mehrheit zustande. Einstimmigkeit ist bei besonders wichtigen Fragen (z.B. bei Steuerfragen (Art. 99 EGV)) vorgesehen.
EU-Kommission
Obwohl die EU-Kommission, als weiteres Machtzentrum der EU, eigentlich nur die Exekutive ohne legislative Entscheidungsbefugnisse bildet, werden auch hier viele Gesetzesvorhaben initiiert, vorbereitet und damit letztlich präjudiziert. Die Kommission besteht zurzeit aus 27 Mitgliedern, Präsidentin ist die Deutsche Ursula von der Leyen (CDU), mit rund 32.000 Bediensteten. Kennen Sie hier den deutschen Vertreter oder die Vertreterin? Die Arbeit der Kommission durchblicken nicht einmal die 720 Abgeordneten des EU-Parlaments. Dabei sind die Aufgaben der Kommission bedeutend. Dazu gehören die Kontrolle der Einhaltung des primären und sekundären Gemeinschaftsrechts, die Erarbeitung und Abgabe von unverbindlichen Stellungsnahmen und Empfehlungen, um das Gemeinschaftshandeln zu aktivieren und die Wahrnehmung eigener Entscheidungsbefugnisse sowie die Mitwirkung am Zustandekommen der Handlungen anderer EU-Organe. Außerdem sieht der EGV für die Kommission eigenständige Entscheidungskompetenzen vor. Diese betreffen die Verwaltung der EU-Haushalte (Art. 205 EGV) und der verschiedenen Fonds sowie der finanziellen Einrichtungen, die Errichtung der Zollunion (Art. 12 ff. EGV), die Erhebung von Ausgleichsabgaben im Bereich der Landwirtschaft (Art. 46 EGV), Schutzmaßnahmen im Bereich des Kapitalverkehrs (Art. 73 Abs. 2 EGV), die Beseitigung von Steuerdiskriminierungen (Art. 100a EGV) und Zustimmungen und Genehmigungen von Beihilfen (Art. 93 Abs. 2 EGV). Und die EU-Kommission wirkt an Handlungen des EU-Parlaments im Rahmen des Haushaltsverfahrens (Art. 203 EGV) und auch an Handlungen des Europäischen Rates mit.
Europäischer Gerichtshof
Die Judikative bildet als dritte Gewalt der Europäische Gerichtshof (EuGH), bestehend aus 13 Richtern, unterstützt von sechs Generalstaatsanwälten. Das Gericht ist zuständig für Verstöße eines Mitgliedslandes gegen Vertragsverpflichtungen und für Verstöße gegen unrechtmäßiges Handeln des Rates und der Kommission. Da die EU aber kein Staat ist und damit auch nicht über ein Gewaltmonopol verfügt, kann der EuGH auch kein Urteil vollstrecken, sondern ist auf die freiwillige Umsetzung der EuGH-Urteile durch die Mitgliedsstaaten angewiesen. Daneben besteht die EU noch aus Nebenorganen wie dem Wirtschafts- und Sozialausschuss, dem Ausschuss der Regionen und dem von den übrigen Organen der EU unabhängigen EU-Rechnungshof. Seit dem 1. Dezember 2009 wurde zudem im Vertrag von Lissabon ein Hoher Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik („EU-Außenminister“ oder „EU-Außenbeauftragter“) eingeführt. Ernannt wird der Hohe Vertreter mit qualifizierter Mehrheit für die Funktionsperiode der EU-Kommission vom Europäischen Rat im Einvernehmen mit dem (der) Kommissionspräsidenten(-in) nach Zustimmung des Europäischen Parlaments. Aktueller Amtsinhaber ist seit dem 1. Dezember 2019 der Spanier Josep Borrell.
Wirtschaftsordnung
Sah der EWG-Vertrag (EGV) von 1967 noch keine expliziten Bestimmungen über eine Wirtschaftsordnung in den Mitgliedsstaaten vor, wobei auch im deutschen Grundgesetz eine solche ausdrückliche Festlegung nicht gegeben ist, so wurde mit dem EGV von 1992 (beschlossen in Maastricht) im Art. 3a EGV und im Art. 102a EGV eine marktwirtschaftlich, wettbewerbliche Ausrichtung der Wirtschaftspolitik für die EU-Staaten rechtlich festgelegt.
„Die Mitgliedstaaten und die Gemeinschaft handeln im Einklang mit dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb, wodurch ein effizienter Einsatz der Ressourcen gefördert wird, und halten sich dabei an die in Artikel 3a genannten Grundsätze (Art. 102a EGV).“
Was heißt hier aber „offene Marktwirtschaft“ und „freier Wettbewerb“? In seiner rechtswissenschaftlichen Dissertation schreibt Henning Schwier: „Das Merkmal der ‚Offenheit‘ wird man dabei in zweierlei Richtungen begreifen müssen. Zum einen beschreibt der Begriff ‚offene Marktwirtschaft‘, dass der europäische Markt jeder natürlichen bzw. juristischen Person zugänglich sein muss, zum anderen soll der Markt aber auch der wirtschaftlichen Initiative interessierter Unternehmer aus Drittländern offenstehen.“ Und: „Hinter dem Begriff des ‚freien Wettbewerbs‘, der (…) zu analysieren ist, verbirgt sich grundsätzlich eine Wirtschaftsordnung, in der private Wirtschaftssubjekte frei von staatlicher, dirigistischer Intervention in Konkurrenz zu einander treten. D.h. hoheitliche Maßnahmen dürfen die Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung nur in begründeten Ausnahmefällen unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit beschränken. Bei systematischer Betrachtung ist jedoch einzuräumen, dass diesem Grundsatz nur eine beschränkte Reichweite zukommt, denn der Freiheit des Wettbewerbs werden durch zahlreiche einschränkende Normenkomplexe im Gemeinschaftsrecht (vgl. Art 81ff., 87f. und 90ff. EVG) eindeutige Grenzen aufgezeigt.“
Dennoch, und das ist soziökonomisch entscheidend, gelten am Ende das Primat des Kapitals und nicht die vom Kapital abhängige Arbeit der Menschen. Das Privateigentum an Produktionsmitteln wird im EU-Vertrag genauso garantiert wie die unternehmerische Freiheit und die Freizügigkeit der Märkte; nicht nur der Finanzmärkte.
Außerdem gilt im ökonomischen Duktus: Die EU selbst darf keine Schulden zur Finanzierung ihres Budgets machen und schreibt den Mitgliedsstaaten in einem Fiskalpakt Schuldenobergrenzen vor, die einen geregelten Keynesianismus ausschließen, dafür aber das Tor für einen marktradikalen Neoliberalismus weit aufstoßen. Das Soziale findet folgerichtig im EU-Vertrag so gut wie nicht statt. Und mit der Einführung des Euro 1999 (Bargeld ab 2002) musste eine Europäische Zentralbank (EZB) gegründet werden. Diese ist rechtlich unabhängig und unterliegt keinen Weisungen und keiner Kontrolle durch das EP. Wirtschaftspolitisch ist die EZB lediglich einer Preisniveaustabilität verpflichtet. Dieser schwerwiegende Fehler ist bis heute nicht berichtigt worden. Notwendig wäre eine Verpflichtung der EZB auf ein makroökonomisches Sechseck: Preisniveaustabilität, Wachstumsnotwendigkeiten und Umwelt, Vollbeschäftigung, Verteilungsgerechtigkeit und ein außenwirtschaftliches Gleichgewicht. Mit ihrer Zinspolitik beeinflusst die EZB die produzierende Wirtschaft, ihr Wachstum und ihre Beschäftigung. Nach der schwerwiegenden Finanz- und Wirtschaftskrise von 2007 bis 2009 wurden der EZB Teile der Bankenaufsicht in den einzelnen Mitgliedsstaaten übertragen.
Und die EZB war neben dem Internationalen Währungsfonds (IWF) und der EU-Kommission maßgeblich an dem diktierten Austeritätsprogramm für Griechenland beteiligt, obwohl das griechische Volk mit einem Volksentscheid gegen die radikalen Kürzungen und Verkäufe staatlichen Eigentums gestimmt hatte. So viel dann zum Demokratieverständnis.
Europäische Repräsentation
Nach der EU-Wahl am 9. Juni werden viele „neue“ Abgeordnete die alten sein. So ist das in einer nur indirekten (parlamentarischen) Demokratie, in der nicht das Volk direkt selbst über Politik entscheidet, sondern das Volk sich vertreten lässt. Wir müssen deshalb sauber formulieren und schreiben, wenn wir uns über Demokratie und Freiheit austauschen. Der herausragende SPD-Politiker Herbert Wehner (1906-1990) sagte einmal: „Der Wähler legitimiert mit seiner Wahl die Entscheidungen, die anschließend gegen ihn unternommen werden.“ So lebt dann das Volk in indirekten Demokratien lediglich in einer Zuschauerdemokratie. Der Schweizer Philosoph Andreas Urs Sommer von der Universität Freiburg i.Br. setzt sich kritisch in seinem Buch „Eine Demokratie für das 21. Jahrhundert. Warum die Volksvertretung überholt ist und die Zukunft der direkten Demokratie gehört“ mit der vorherrschenden politischen Repräsentation auseinander.
„Repräsentation bedeutet, dass andere für mich stehen. Andere, wird man einwenden, die ich immerhin in regelmäßigen, freien und geheimen Wahlen gewählt habe – sofern ich mich nicht sogar selbst zur Wahl habe aufstellen lassen. Andere, so erwidere ich, die ein freies Mandat haben, nicht an meine Wünsche, Präferenzen und Interessen gebunden sind und ein paar Jahre lang für mich, für all ihre Wähler und im Namen des gesamten Volkes Sachentscheidungen treffen werden, in die dieses gesamte Volk ansonsten nicht eingebunden ist. Die uns und mich unmittelbar betreffen, ohne dass ich an ihnen teilgehabt hätte.“
Eigentlich erschließt sich daraus die Ursache für eine dramatisch zugenommene und viel beklagte Politikverdrossenheit von selbst, wenn Politik völlig intransparent und gegen die Interessen der großen Mehrheit des Volkes gerichtet ist. Bei der letzten Bundestagswahl 2021 stellten die Nicht-Wähler die größte „Partei“. Bezogen auf die Wahlberechtigten ist die derzeitige „Ampel-Regierung“, bestehend aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP, nur von 49,5 Prozent, also knapp der Hälfte der Bürgerinnen und Bürgern gewählt worden. Die letzte Wahl zum EP (2019) fiel noch suboptimaler aus. Die Wahlbeteiligung lag hier bei nur 50,7 Prozent und in Deutschland immerhin bei 61,4 Prozent.
Politiker und Parteien verfolgen in indirekten parlamentarischen Demokratien Eigeninteressen, die zwar auch am Gemeinwohl orientiert sein können, aber nicht müssen, sondern in der Regel vielmehr nur Partialinteressen mächtiger Wirtschaftseliten befriedigen. Hier besteht potenziell immer die Gefahr einer Verselbstständigung. Das wissen wir bereits auf nationaler Ebene, ohne hier auch nur einen kurzen Blick nach Europa zu werfen. „Der Bundestag agiert abgehoben und fern der Lebensrealität der Menschen“, kritisiert die Soziologie-Professorin Christiane Bender von der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr Hamburg in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau. Und in einer jüngsten repräsentativen Umfrage stellt die Körber-Stiftung fest: 71 Prozent der Deutschen finden, dass führende Leute in Politik und Medien in ihrer eigenen Welt leben, aus der sie auf den Rest der Bevölkerung herabschauen, und fast die Hälfte der Deutschen (46 Prozent) findet, dass es im Land weniger bis gar nicht gerecht zugeht.
Um es aber im Land gerecht zugehen zu lassen, dafür gäbe es in Deutschland, in Summe eines der reichsten Länder der Erde, einen hinreichenden umverteilenden Spielraum beim Einkommen. Gleichzeitig bestünde auch die Möglichkeit, in die völlig ungleiche Vermögensverteilung politisch einzugreifen. Dies vollzieht aber eben eine interessenorientierte Politik für wenige nicht – auch nicht in der EU, und daran wird auch die EU-Wahl nichts verändern. Insofern ist die Wahl lediglich eine Legitimation für 720 Abgeordnete, im beschriebenen, völlig unzureichenden demokratischen EU-System weiter eine Politik zu betreiben, die an der Mehrheit der Menschen in den EU-Staaten vorbeigeht. Systemische Veränderungen für mehr Demokratie sind hier nicht zu erwarten.
Leserbriefe zu diesem Beitrag finden Sie hier.
Titelbild: isso-online.de