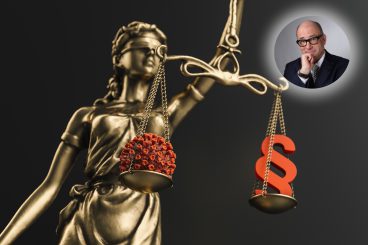„Während Corona haben wir die extremsten Grundrechtseinschränkungen gesehen, die es in der Bundesrepublik bisher gegeben hat. Die Richter hätten sehr kritisch und sehr genau hinschauen müssen, was die staatlichen Institutionen machen. Sie hätten Rote Linien der Freiheit ziehen müssen. Das hätte eine Signalwirkung für die anderen Gerichte gehabt. Stattdessen haben sie unkritisch fast alle staatlichen Maßnahmen mit dem Stempel der Verfassungsmäßigkeit versehen.“ – mit diesen Worten äußert sich der Verfassungsrechtler Volker Boehme-Neßler im Interview mit den NachDenkSeiten. Scharf kritisiert er das Bundesverfassungsgericht, aber auch generell die Justiz im Hinblick auf die „Corona-Rechtsprechung“. Boehme-Neßler spricht von einem „Verrat am Gedanken des Rechtsstaats“. Der Rechtswissenschaftler hält außerdem die Impfpflicht bei der Bundeswehr für „verfassungswidrig“ und fordert eine Aufarbeitung die Justiz betreffend. Von Marcus Klöckner.
Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.
Podcast: Play in new window | Download
Marcus Klöckner: Herr Boehme-Neßler: Wo war das Recht in der Coronakrise?
Volker Boehme-Neßler: Es war nicht da, wo es gebraucht wurde. Das Recht war teilweise faktisch außer Kraft gesetzt. Vor allem die Gerichte haben ihre Aufgabe nahezu nicht erfüllt. Was wir während der Coronakrise erlebt haben, war eines Rechtsstaats nicht würdig. Die Idee des Rechtsstaats ist ja: Das Recht gilt immer, auch und gerade in der Krise. Das haben wir leider anders erlebt.
Viele Bürger, die die Maßnahmen kritisch betrachtet haben, sprechen immer wieder auch das Verhalten der Justiz an. Lassen Sie uns bitte genauer auf die Gerichte und die Vertreter der Gesetze schauen. Wie hätten sich denn aus Ihrer Sicht die Gerichte verhalten müssen? Was wäre der grundlegende Weg gewesen?
Die Gerichte hätten die Aufgabe erfüllen müssen, die sie im Rechtsstaat haben.
Nämlich?
Sie müssen prüfen, ob das Recht eingehalten wird. Ist das, was geschieht, mit dem geltenden Recht vereinbar? Das ist die Frage, die Gerichte klären müssen, wenn sie von Bürgern angerufen werden.
Und das war nicht der Fall? Was hätten die Gerichte noch tun müssen?
Die Gerichte hätten in jedem einzelnen Fall akribisch und konkret prüfen müssen, ob die einschlägigen Rechtsnormen eingehalten werden. Das gilt für jedes Rechtsgebiet. Sie hätten etwa im Arbeitsrecht in den vielen konkreten Fällen, die ihnen zur Entscheidung vorlagen, prüfen müssen, ob alle coronabedingten Maßnahmen der Arbeitgeber rechtmäßig waren. In der Arbeitswelt gab es zahllose, nicht selten an die Existenz gehende Konflikte. Da wären Arbeitsgerichte mit abgewogenen Konfliktlösungen sehr nötig gewesen. Sie hätten – anderes Beispiel – im Verwaltungsrecht alle Coronamaßnahmen der staatlichen Behörden auf ihre Rechtmäßigkeit prüfen müssen. Viel zu oft haben sich die Richter darauf beschränkt, staatliche Maßnahmen völlig unkritisch als rechtmäßig anzusehen.
Können Sie ein Beispiel anführen?
Behörden haben fast routinemäßig Demonstrationen gegen Coronamaßnahmen verboten – ein harter Eingriff in die Meinungs- und Demonstrationsfreiheit der Bürger. Das haben Verwaltungsgerichte viel zu oft und viel zu voreilig als rechtmäßig akzeptiert.
Wie sieht es denn mit dem Bundesverfassungsgericht aus?
Da sprechen Sie ein ganz wichtiges und sensibles Thema an. Der Fisch stinkt vom Kopf her, sagt man. Das zeigt sich auch hier wieder. Das Bundesverfassungsgericht ist das oberste deutsche Gericht. Es prägt natürlich die gesamte Justiz. Es legt die Verfassung aus. Damit macht es Vorgaben für alle Gerichte.
Das Gericht in Karlsruhe sieht sich selbst als „Hüter der Verfassung“. Es passt auf, dass die Verfassung durch staatliches Handeln nicht beschädigt wird. In der Coronazeit wäre es deshalb seine Aufgabe gewesen, die staatlichen Coronamaßnahmen auf ihre Verfassungsmäßigkeit zu prüfen. Diese Aufgabe hat es – leider – während der Coronakrise nicht erfüllt. Während Corona haben wir die extremsten Grundrechtseinschränkungen gesehen, die es in der Bundesrepublik bisher gegeben hat. Die Richter hätten sehr kritisch und sehr genau hinschauen müssen, was die staatlichen Institutionen machen. Sie hätten Rote Linien der Freiheit ziehen müssen. Das hätte eine Signalwirkung für die anderen Gerichte gehabt. Stattdessen haben sie unkritisch fast alle staatlichen Maßnahmen mit dem Stempel der Verfassungsmäßigkeit versehen. Das hatte dann eine entsprechende Signalwirkung für die unteren Instanzen der Justiz und erklärt die repressive Rechtsprechung der unteren Instanzen.
Was haben Sie auf der juristischen Ebene im Hinblick auf die „Coronarechtsprechung“ beobachtet?
Ich habe vor allem Angst gespürt und beobachtet. Fast kein Gericht wollte etwas riskieren. Ich hatte den starken Eindruck, dass auch in der Justiz – wie in anderen Teilen der Gesellschaft – unausgesprochen der Ausnahmezustand herrschte. Die Richter haben sich mehr als loyale Staatsdiener gesehen statt als unabhängige und kritische Richter. Kein Richter wollte riskieren, durch ein freiheitsfreundliches Urteil möglicherweise Ansteckungen zu fördern. Keiner wollte in der Ecke der „Querdenker“ oder „Coronaleugner“ landen.
Angst verhindert klares und rationales Denken – und sie macht streng, freiheitsfeindlich und rigide. Wie für den großen Teil der Gesellschaft galt das auch für die Justiz. Das soll eigentlich die Stärke der Gerichte sein: rational analysieren und präzise Problemlösungen auf der Grundlage des geltenden Rechts entwickeln. Dadurch schützen sie die Freiheit der Bürger, wie sie die Gesetze garantieren. In der Coronazeit habe nicht nur ich fast ausnahmslos Angsturteile beobachtet, die im Zweifel repressiv die Einschränkung der Freiheiten gerechtfertigt haben.
Wie erklären Sie sich das? Warum haben Gerichte sich so verhalten?
Richter sind auch nur Menschen und können sich dem allgemeinen Klima in der Gesellschaft nicht entziehen. Wenn wir uns erinnern: Das gesellschaftliche Klima war geprägt von Angst und Hysterie. Das berüchtigte Angst-Papier aus dem Bundesinnenministerium vom März/April 2020 belegt, dass diese Angst von der Spitzenpolitik bewusst und permanent geschürt wurde. Gleichzeitig wurden auch Kritiker bösartig stigmatisiert und brutal ausgegrenzt. Das hat natürlich auch verhindert, dass Gerichte genau hingeschaut und staatskritisch geurteilt haben. Man brauchte schon viel Mut und Standhaftigkeit, um in diesen Zeiten kritisch aufzutreten, auch als Richter.
Können Sie an einem Beispiel zusammengefasst aufzeigen, wo konkret Sie die Rechtsprechung kritisieren? Vielleicht am Beispiel des Bundesverfassungsgerichts, Stichwort „Bundesnotbremse“?
Die beiden Beschlüsse zur Bundesnotbremse vom November 2021 zeigen deutlich, welche Defizite die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in der Coronakrise hat. Im Verfassungsrecht geht es oft um Abwägungen zwischen unterschiedlichen Rechtsgütern. Hier musste abgewogen werden zwischen der Gefahr durch das Virus für die Allgemeinheit einerseits und den Freiheitseinschränkungen für die Einzelnen andererseits. Auffällig ist, dass das Gericht die Abwägungen des Gesetzgebers kaum nachprüft. Es räumt der Politik einen weiten „Beurteilungsspielraum“ ein, mit anderen Worten: Es hält sich raus. Das ist normalerweise anders.
Ungewöhnlich ist auch, wie auffällig selektiv und erschreckend oberflächlich das Gericht die wissenschaftlichen Informationen zur Pandemie rezipiert und in den Urteilen verarbeitet. Normalerweise bringt sich das Gericht vor seinen Entscheidungen akribisch auf den aktuellen Stand des relevanten Wissens – hier überhaupt nicht. Auch hier wieder: Das Gericht steigt nicht wirklich in die Thematik ein und hält sich raus. Deshalb hört es in diesen Verfahren zur Bundesnotbremse vor allem Sachverständige und Experten, die die Linie der Bundesregierung stützen.
Kann man sagen, dass es in der Coronakrise oftmals keine Rechtsprechung im Sinne des Rechts mehr gegeben hat, sondern eine Rechtsprechung im Sinne der Politik?
Etwas zugespitzt kann man das sagen. Die Aufgabe gerade der Verwaltungsgerichte und des Verfassungsgerichts ist, die Politik und die staatlichen Behörden zu kontrollieren. Das haben die Gerichte in der Coronakrise viel zu selten gemacht. Dadurch haben sie letztlich die repressiven Maßnahmen der Behörden unterstützt. Das ist ein Verrat am Gedanken des Rechtsstaats. Die Idee des Rechtsstaats ist nämlich gerade, die (politische) Macht durch das Recht zu begrenzen. Das funktioniert aber nur, wenn wir unabhängige Gerichte und Richter mit Zivilcourage haben.
Was heißt es für eine Demokratie, was heißt es für einen Rechtsstaat, wenn Bürger spüren, dass sie bei schwersten Grundrechtseingriffen kaum noch rechtliches Gehör finden?
Ich denke, dass dieses Verhalten der Gerichte den Rechtsstaat schwer beschädigt hat. Grundrechte sollen ja die Freiheit der Bürger garantieren. Dazu gehört natürlich auch, dass Gerichte den Bürgern im Konfliktfall helfen, ihre Grundrechte gegen den übergriffigen Staat durchzusetzen. Wie soll man denn im Rechtsstaat Grundrechte ohne Gerichte durchsetzen? Grundrechte, die nur auf dem Papier stehen, sind nichts wert. Das Verhalten der Justiz hat das Vertrauen in den funktionierenden Rechtsstaat heftig erschüttert. Das wird Spätfolgen haben, die wir noch gar nicht absehen können. Schon jetzt zeigen Umfragen, dass das Vertrauen der Bürger in den Staat und seine Institutionen abgenommen hat – und immer weiter abnimmt.
Eine ganze Weile stand die Corona-Impfpflicht im Raum. Auch wenn die allgemeine Corona-Impfpflicht abgelehnt wurde: Von staatlicher Seite wurde ein massiver Impfdruck erzeugt. Bürger waren aufgrund bestimmter Lebenssituationen regelrecht gezwungen, sich der Corona-Impfung zu unterziehen. Eine Weigerung hätte für manche schwere Folgen nach sich gezogen: Verlust des Arbeitsplatzes, ökonomischer Zusammenbruch. Nun wissen wir: Diese Impfung war nicht „nebenwirkungsfrei“. Wir hören in Medien von schwersten Nebenwirkungen bis hin zum Tod. Wie bewerten Sie im Hinblick auf diese Schadensfälle das Verhalten des Staates?
Der Impfdruck war extrem. Daran sind Menschen zerbrochen. Und unzählige Menschen haben sich impfen lassen, obwohl sie das nicht wirklich wollten.
Wir haben in dieser Zeit nicht den demokratischen Rechtsstaat gesehen, den die Verfassung will. Wir waren stattdessen mit einem autoritären Obrigkeitsstaat konfrontiert, der Ängste geschürt, Maßnahmen ohne Rücksicht auf Verluste durchgesetzt und Kritiker ausgegrenzt hat. Das Problem ist: Es geht so ähnlich weiter. Als Wiedergutmachung wäre es angebracht, wenn der Staat wohlwollend und großzügig für die teilweise furchtbaren Impfschäden entschädigt. Davon ist nichts zu sehen, ganz im Gegenteil. Impfgeschädigte müssen mit zahllosen bürokratischen Hindernissen kämpfen und sich durch die Instanzen klagen. Das zeugt nicht von Einsicht bei den staatlichen Akteuren, eher von Vertuschung durch Bürokratie.
Gestatten Sie mir, die Frage zu präzisieren. Durften verantwortliche Politiker, durfte „der Staat“ so vorgehen, wie er vorgegangen ist? Bei Lichte betrachtet konnte der Staat Nebenwirkungen und Langzeitfolgen der Impfung nicht ausschließen, im Gegenteil: Er hätte meines Erachtens geradezu wissen müssen, dass es zu Schäden kommen wird. Was ist hier passiert? Hat hier der Staat Leben gegen Leben aufgewogen? Hat hier der Staat bewusst die Schädigung des Lebens von zumindest einigen Staatsbürgern in Kauf genommen, um – so der Tenor – doch das Leben „von vielen“ zu schützen? Wie sieht diesbezüglich eine rechtliche Würdigung aus?
Der Staat hat die Schädigung einiger Staatsbürger in Kauf genommen, um das Leben von vielen zu schützen. Das war die offizielle Linie. Das Problem dabei ist: Der Staat hätte wissen müssen, dass die Sachlage nicht so eindeutig ist, wie er sie kommuniziert. Die maßgebenden Politiker waren nicht immer ehrlich. In der von Angst und Hysterie geprägten Stimmung galt die Impfung als der Königsweg aus der Pandemie. Man konnte schon damals wissen, dass das eine falsche Hoffnung war.
Die Politik war aber schon auf dem autoritären Weg, die Bürger unter Druck zu setzen und zu zwingen. Sie wollte – aus welchen Gründen auch immer – diese Strategie nicht mehr ändern. Das ging maßgeblich auf die damalige Bundeskanzlerin Merkel zurück. (Fast) alle Spitzenpolitiker waren sich mit ihr einig. Die Politik wollte den autoritären Weg gehen und die Bürger zwingen. Das war nicht wirklich demokratisch. In der Demokratie hätte man einen vernünftigen und maßvollen Weg gehen und die Bürger zutreffend informieren müssen. Man hätte um Zustimmung für die Corona-Politik werben müssen. Der autoritäre und manipulative Ansatz war in meinen Augen der grundsätzliche und schlimme Fehler des Staates in der Pandemie.
Ich habe Anfang 2022 ein Rechtsgutachten zur verfassungsrechtlichen Zulässigkeit einer allgemeinen Impfpflicht veröffentlicht. Darin komme ich klar zum Ergebnis: Eine allgemeine Impfpflicht wäre verfassungswidrig gewesen. Und die existierenden (Teil-)Impfpflichten waren und sind verfassungswidrig. Also meine Antwort ist klar: Der Staat durfte so nicht handeln. Der Druck, der auf die Bürger ausgeübt wurde, entsprach faktisch fast einer rechtlichen Pflicht zur Impfung. Es war sozusagen eine „Impfpflicht durch die Hintertür“. Das war verfassungswidrig.
Karl Lauterbach schrieb im August 2021 in einem Tweet auf der Plattform Twitter (jetzt X) Folgendes: „Und zusätzlich geht es darum, weshalb eine Minderheit der Gesellschaft eine nebenwirkungsfreie Impfung nicht will, obwohl sie gratis ist und ihr Leben und das vieler anderer retten kann.“ Was sagt der Jurist in Ihnen dazu?
Die Aussage war schon nach dem damaligen Wissensstand völlig falsch, und der Minister wusste das. Jedenfalls hätte er es wissen können und müssen. Der Verfassungsjurist in mir ist schockiert, dass ein herausragender Vertreter des demokratischen Rechtsstaats – ein Bundesminister – solche massiv falschen Behauptungen aufstellt. Und er findet es verstörend, dass dieser Mann immer noch im Amt ist. Der Politikwissenschaftler in mir allerdings wundert sich nicht. Dass die Wahrheit in der Politik nicht das Wichtigste ist, ist nicht wirklich neu.
Wie blicken Sie auf die noch immer geltende Corona-Impfpflicht bei der Bundeswehr?
Ich halte diese Impfpflicht bei der Bundeswehr für verfassungswidrig. Sie muss sofort abgeschafft werden. Es ist eine Schande, dass sie immer noch besteht. Es gibt immer mehr Informationen darüber, dass die Impfung nur eine sehr begrenzte Wirkung hat, gleichzeitig aber zahlreiche schwere Nebenwirkungen. Abgesehen davon ist klar, dass das Virus viel von seinem Schrecken verloren hat. Vor diesem Hintergrund ist mir völlig unverständlich, wie man die Soldaten und Soldatinnen zu einer Impfung zwingen kann, die ein tiefer Eingriff in ihre Gesundheit ist. Sie verletzt die Grundrechte der Soldaten. Und es erschreckt mich, wie sehr der Verteidigungsminister seine Fürsorgepflicht vernachlässigt, die er gegenüber seinen Soldaten hat.
Wir haben bis jetzt weitestgehend über das Geschehen in den vergangenen Jahren gesprochen. Lassen Sie uns den Fokus auf die aktuelle Zeit richten. Wie sieht es denn nun aus? Noch immer laufen ja Verfahren wegen Verstößen gegen die Coronamaßnahmen. Verfolgen Sie die aktuelle Rechtsprechung? Was fällt Ihnen auf?
Ich verfolge nicht akribisch die gesamte aktuelle Rechtsprechung. Aber es häufen sich Berichte über Urteile, die jetzt im Nachhinein Coronamaßnahmen kritischer sehen und aufheben. Das macht mich vorsichtig optimistisch. Vielleicht fangen die Gerichte an, ihre Corona-Schockstarre und ihre Staatsfixiertheit zu überwinden. Das wäre wenigstens ein Anfang.
Aber schockierend ist, dass Behörden immer noch mit allen rechtlichen Mitteln Bußgelder wegen Verstößen gegen Coronaregeln eintreiben. Ein Beispiel: Man weiß, dass Maskenpflichten weitgehend sinnlos waren. Trotzdem werden immer noch Ärzte vor Strafgerichten angeklagt und verurteilt, weil sie – angeblich – falsche Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht ausgestellt hätten. Ein Amtsrichter aus Weimar steht wegen Rechtsbeugung vor Gericht. Sein Vergehen: Er hatte 2021 verfügt, dass die Kinder in zwei Schulen keine Masken tragen müssten. Staatliche Behörden treiben immer noch Bußgelder von Bürgern ein, die das Maskentragen verweigert hatten. Rein formalrechtlich mag das alles vielleicht gehen, aber politisch und psychologisch ist das verheerend.
Slowenien geht einen anderen Weg. Dort werden Corona-Bußgelder zurückgezahlt. Das wäre auch in Deutschland ein guter Anfang auf dem Weg zur Aufarbeitung der Pandemie und zur Versöhnung der Gesellschaft. Aus meiner Sicht wäre auch eine generelle Amnestie für „Corona-Taten“ ein wichtiger Schritt, das Unrecht, das in der Pandemie geschehen ist, wiedergutzumachen. Das Cannabis-Gesetz zeigt, dass solche Amnestien möglich sind, wenn man politisch will.
Derzeit wird viel über das Thema Aufarbeitung gesprochen. Wie denken Sie über eine Aufarbeitung im Hinblick auf die Rechtsprechung? Bedarf das Verhalten der Justiz einer eigenen Aufarbeitung?
Selbstverständlich muss auch die Rolle der Justiz in der Coronakrise aufgearbeitet werden. Es braucht akribische und detaillierte Forschung, warum die Justiz so staatsfromm, so wenig kritisch war. Und man muss darüber diskutieren, wie man in Zukunft verhindert, dass Gerichte in einer Krise ihre Kontrollaufgaben vergessen. Dazu braucht es eine doppelte Aufarbeitung – eine interne und eine externe. Die Justiz muss selbst einen Beitrag leisten. Ein selbstkritisches Reflektieren des eigenen Verhaltens könnte eine heilsame Wirkung innerhalb der Justiz entfalten. Das wird aber aus naheliegenden Gründen nicht ausreichen. Die Rolle der Justiz muss auch von anderen Instanzen der Gesellschaft aufgearbeitet werden. Das wären etwa die Politik, die Gesellschaft, die Historiker und nicht zuletzt die Rechtswissenschaft.
Das wäre doch bestimmt eine Mammutaufgabe. Wie könnte eine Aufarbeitung im Bereich der Justiz ablaufen?
Aufarbeitung ist in allen Bereichen der Gesellschaft nötig – nicht nur in der Justiz, sondern natürlich auch in der Politik, den Medien, der Wissenschaft und der Medizin. Und in allen Bereichen ist es eine Mammutaufgabe. Das liegt weniger daran, dass unglaublich viele Informationen gesammelt, analysiert und bewertet werden müssten. Die Aufarbeitung ist vor allem deshalb schwierig, weil es weite Kreise in Politik und Gesellschaft gibt, die keine Aufarbeitung wollen. Viele der damaligen Entscheider sind noch im Amt. Sie wollen sich – fast hätte ich gesagt: natürlich – nicht der Kritik stellen.
Und auch die meisten Mitläufer wollen keine Aufarbeitung. Sie haben ja bei der maßlosen, nicht selten brutalen Ausgrenzung der Kritiker und der Ungeimpften mitgemacht. Das war kein gutes Verhalten. Das möchte sich keiner eingestehen. So ist die Lage natürlich auch in der Justiz. Die Richter, die während der Coronakrise geurteilt haben, sind immer noch im Amt. Sie müssten ihre eigenen Fehler und Schwächen offenlegen und analysieren. Das macht die Aufarbeitung schwierig. Hoffentlich gibt es Impulse zur Aufarbeitung auch innerhalb der Justiz. In jedem Fall müssen sich aber die Gesellschaft und die Politik von außen mit der Rolle der Justiz in der Pandemie beschäftigen.
Jens Spahn hat gesagt, in Sachen Aufarbeitung dürfe es keinen „Querdenkergerichtshof“ geben. Sind Sie auch für eine Aufarbeitung in Bezug auf die Politik? Wie könnte eine Aufarbeitung, die dem Namen gerecht wird, aussehen?
Es gibt sehr zu denken, dass Jens Spahn weiter die böse Ausgrenzungsvokabel „Querdenker“ benutzt. Das zeigt, dass es ihm nicht um echte Aufarbeitung geht.
Selbstverständlich muss es eine schonungslose Aufarbeitung auch in der Politik geben. Man muss – nur als Beispiel – darüber sprechen, warum Angela Merkel und die anderen Spitzenpolitiker eine dezidierte Angst-Politik betrieben haben. Warum wurden die Bürger von der Politik permanent in Angst und Schrecken versetzt? In einer Demokratie wäre es angemessen gewesen, die Bürger vernünftig zu informieren und von rationalen Maßnahmen und Lösungen zu überzeugen. Wieso haben große Teile der Politik so sehr gegen Kritiker und ungeimpfte Bürger gehetzt? Das passte nicht zur Demokratie des Grundgesetzes. Das hat Spätschäden verursacht, die wir noch gar nicht alle übersehen können. Selbstverständlich muss auch die Rolle von konkreten Personen untersucht und aufgearbeitet werden. Dabei ist sicherlich die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Schlüsselfigur. Auch ihre Rolle muss schonungslos und akribisch analysiert und bewertet werden. Im demokratischen Rechtsstaat geht es nicht um Rache, aber um Verantwortlichkeit und Schuld schon.
Titelbild: r.classen/shutterstock.com