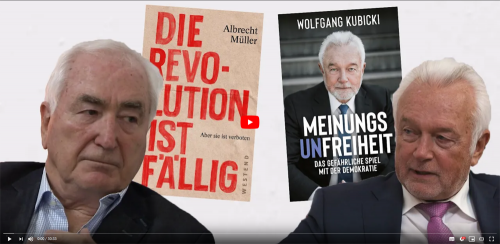Die neue Verschärfung des Disziplinarrechts für Beamte ist das aktuellste Beispiel der Entwicklung, dass immer neue Regeln erlassen werden, die den Meinungskorridor einschränken und kritische Bürger einschüchtern sollen. Die in dieser Entwicklung indirekt vorgenommene Gleichsetzung der Regierung mit „der Demokratie“ ist abzulehnen. „Medienfreiheitsgesetz“, Digital Services Act, „Demokratiefördergesetz“ heißen einige weitere fragwürdige Projekte. Extra unscharfe Begriffe wie „Gefährdungspotenzial“ und neue Tatbestände wie „verfassungsfeindliche Delegitimierung des Staates“ verwischen wichtige Grenzen. Ein Kommentar von Tobias Riegel.
Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.
Podcast: Play in new window | Download
Seit dem 1. April gilt das neue Disziplinarrecht für Beamte. Der Bundestag hatte die Reform, welche „die bisher langwierigen“ Disziplinarverfahren beschleunigen soll, im November beschlossen, wie das ZDF schreibt. Bislang habe der Dienstherr eine Entfernung aus dem Beamtenverhältnis nur per Disziplinarklage vor dem Verwaltungsgericht erreichen können. Diese Verfahren würden im Schnitt vier Jahre dauern, in denen die Betroffenen weiterhin einen beträchtlichen Teil ihrer Bezüge erhalten, so das ZDF.
Die Reform sehe vor, dass die Behörden künftig selbst eine Disziplinarverfügung gegen „extremistische Beamte“ erlassen können – die dann im Nachhinein vom Verwaltungsgericht geprüft wird. Die Verfügung könne sämtliche Disziplinarmaßnahmen einschließlich der Zurückstufung, der Entfernung aus dem Beamtenverhältnis und der Aberkennung des Ruhegehalts umfassen. Die Betroffenen könnten gegen die Verfügung Klage einreichen. Zudem sei vorgesehen, dass eine Verurteilung wegen Volksverhetzung bei einer Freiheitsstrafe ab sechs Monaten zum Verlust der Beamtenrechte führt. Die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) fasst zugespitzt zusammen:
„Ab sofort können Extremisten schneller aus dem deutschen Staatsdienst entfernt werden, und dafür braucht es auch kein Gericht mehr, sondern nur noch die eigene Behörde. Der entlassene Beamte kann sich wieder einklagen, wenn er der Überzeugung ist, dass ihm Unrecht geschah.“
„Wer den Staat ablehnt, kann ihm nicht dienen“, hatte Innenministerin Nancy Faeser zur Begründung laut NZZ gesagt, aber die Zeitung fragt sich: „Wie weist man das nach? Auch Beamte haben ein Recht auf freie Meinungsäusserung und auf politische Betätigung; zugleich unterliegen sie dem Mässigungsgebot.“ Die NZZ fährt fort:
„Die Gesetzesänderung geschieht in einer politischen Umgebung, in der der Begriff ‚verfassungsfeindlich‘ immer weiter aufgeweicht wird. So galten schon Lehrer als verfassungsfeindlich, wenn sie gegen die Schulschliessungen der Corona-Zeit waren, und für ‚Querdenker‘ und Impfgegner wurde sogar eine eigene Kategorie im Verfassungsschutzbericht erfunden: die der ‚verfassungsfeindlichen Delegitimierung des Staates‘.“
Das neue Disziplinarrecht umfasse auch Richter. Bis zum Äußersten gedacht, könne es laut NZZ gar die Möglichkeit einer „bereinigten Justiz“ eröffnen. Zudem sei die Beweislast umgedreht: Der aus dem Dienst entfernte Beamte müsse seine Tadellosigkeit nachweisen. Er habe dabei nicht mehr seine vollen Bezüge, und falls er sich als der Bezahlung „nicht würdig“ erweise, bekomme er sogar gar nichts.
Wer möchte schon „Extremisten“? Aber wer definiert das?
Es würde sich wohl niemand prinzipiell für die Beschäftigung von „Extremisten“ einsetzen und ich finde ein Urteil von sechs Monaten wegen Volksverhetzung keineswegs eine Petitesse. Es muss selbstverständlich möglich sein, tatsächlich extremistische Beamte aus dem Dienst zu entfernen.
Wichtige Fragen bei dem Gesetz sind aber: Wer trägt Sorge dafür, dass die aktuelle Verschärfung kein Einfallstor ist und nicht nur der Anfang einer mit edlen Motiven begründeten, aber immer strenger vollzogenen Gesinnungsprüfung im Staatsdienst? Wer definiert „Extremismus“ und wo genau liegt die Grenze, ab der politische Positionen juristisch relevant werden? Und wer sogt dafür, dass diese juristische Grenze nicht künftig durch vorsätzlich schwammige Formulierungen aufgeweicht wird?
Denn auf anderer Ebene werden Begriffe bereits aufgeweicht und Grenzen verschoben, wie wir in diesem Artikel am Beispiel „Gefährdungspotenzial“ durch Innenministerin Nancy Faeser und Verfassungsschutzchef-Chef Thomas Haldenwang geschrieben haben:
„Wie so oft können Vorhaben, die bei ihrer Einführung mit ‚edlen‘ Motiven verknüpft sind, potenziell auch für bedenkliche Tendenzen genutzt werden, wenn sie erst einmal beschlossen sind – und vor allem dann, wenn die Tatbestände nicht scharf genug definiert sind. Das ist bei Faesers Plänen der Fall, denn hier soll ein schwammig umrissenes ‚Gefährdungspotenzial‘ die bisherigen Kriterien wie ‚volksverhetzende und gewaltorientierte Bestrebungen‘ ergänzen, was den Raum für Willkür öffnen könnte.“
Bezüglich des neuen Beamtenrechts finde ich scharf abzulehnen, wenn die Entscheidung über die Entfernung aus dem Dienst künftig vom Dienstherrn selber getroffen würde und die Betroffenen sich in einer indirekten Umkehr der Beweislast wieder einklagen müssten. Und wer sich damit beruhigt, dass die Verschärfung ja nur „rechte Extremisten“ trifft, der sollte sich nicht wundern, wenn sie bald auf Regierungskritiker jeglicher Couleur angewendet würde.
„Die Meinungsfreiheit ist kein Freibrief“
Haldenwang hat sich kürzlich erneut fragwürdig geäußert, diesmal zur Meinungsfreiheit, und behauptet: „Die Meinungsfreiheit ist kein Freibrief für Verfassungsfeinde“. In dem Zusammenhang ging der Verfassungsschutzchef-Chef auch auf die in diesem Text bereits angesprochene problematische Verunklarung der Grenze des juristisch Erlaubten oder eben Verbotenen ein:
„Aber dennoch: Auch die Meinungsfreiheit hat Grenzen. Die äußersten Grenzen zieht das Strafrecht, etwa in Hinsicht auf strafbare Propagandadelikte oder Volksverhetzung. Jedoch auch unterhalb der strafrechtlichen Grenzen und unbeschadet ihrer Legalität können Meinungsäußerungen verfassungsschutzrechtlich von Belang sein.“
Peter Voß stellt in der FAZ dazu berechtigte Fragen, die auch zur Frage der in diesem Artikel behandelten Verschärfung des Beamtenrechts passen:
„Wollen wir es mit primär juristischen und administrativen Mitteln unterbinden, dass ein Mensch, der in seiner prinzipiellen Irrtumsfähigkeit zu der Auffassung gelangt, die Demokratie im klassischen Verständnis sei nicht der Weisheit letzter Schluss, dies öffentlich kundtut und vertritt, oder sollten wir das im Sinne der Meinungsfreiheit nicht besser nur dann tun, wenn er es mit der Anstiftung zu Hass und Gewalt verbindet? Und muss ihm, wenn er in diesen Verdacht gerät oder gerückt wird, der Staat das schuldhafte Verhalten nachweisen, oder muss er, etwa als Beamter, seine Unschuld beweisen?“
Und auch die folgende Frage ist wichtig – auch wenn das dort genutzte Wort „links“ durch „pseudo-links“ ersetzt werden sollte:*
„Bedenken manche eher links gesinnte Journalisten gar nicht, dass alle Instrumente, die im vermeintlichen Kampf ‚gegen Rechts‘ bereitgestellt werden, früher oder später auch gegen sie eingesetzt wenden können, etwa wenn sie (vermeintlich) demokratische Politiker ‚verächtlich‘ machen und damit angeblich die Demokratie um ihren Kredit bringen?“
„Diese Gesetzesänderung damit zu begründen, ist jedoch fernab der Realität“
Wie viele „Extremisten“ tummeln sich denn im Staatsdienst? Der „Deutsche Beamtenbund“ hatte bereits im vergangenen Juni die Notwendigkeit der Gesetzesänderung stark in Zweifel gezogen:
„Die Folge des neuen Entwurfs ist kein schnelleres Ausmustern verfassungsfeindlicher Beamtinnen und Beamten, sondern nur mehr Misstrauen in der Bevölkerung gegenüber den Beschäftigten. Und das obwohl es sich bei den anvisierten faulen Äpfeln um sehr seltene Einzelfälle handelt. Selbst laut der Gesetzesbegründung gab es 2021 nur 373 Disziplinarmaßnahmen, gleichbedeutend mit 0,2 Prozent der Bundesbeamtinnen und Bundesbeamten. Die Anzahl der Disziplinarklagen im gleichen Zeitraum betraf 25 Fälle oder 0,01 Prozent der Bundesbeamtinnen und Bundesbeamten. Es ist anzunehmen, dass es hier nicht ausschließlich um verfassungsfeindliche Handlungen ging, denn Disziplinarverfahren können auch wegen anderem Fehlverhalten eingeleitet werden. Selbstverständlich müssen wir mit allen Mitteln gegen Verfassungsfeindlichkeit vorgehen, diese Gesetzesänderung damit zu begründen, ist jedoch fernab der Realität.“
Meiner Meinung nach kann die Verschärfung des Gesetzes auch dazu führen, Staatsdiener allgemein politisch einzuschüchtern – und eben nicht nur die „Extremisten“ unter ihnen. Damit wäre auch auf dieser Ebene der Debattenraum wieder ein Stück kleiner geworden.
Diese Entwicklung der vorsätzlichen Verengung des „erlaubten“ Meinungskorridors sowie die tendenzielle Verwischung der Grenzen zwischen „illegal“ und „zwar erlaubt, aber gefährdend“ wurde in jüngerer Vergangenheit auf anderen Ebenen bereits eingeschlagen: mit dem „Medienfreiheitsgesetz“, dem Digital Services Act oder dem geplanten „Demokratiefördergesetz“ (usw.) – mehr zu diesen Themen unter diesem Text.
* Aktualisierung 11.4.2024, 11h: Dieser Satz wurde ergänzt.
Leserbriefe zu diesem Beitrag finden Sie hier.
Titelbild: KieferPix / Shutterstock
Mission erfüllt: Bürger haben jetzt Angst, ihre Meinung zu äußern
Die drohende „Herrschaft des Verdachts“: Der Digital Services Act der EU
„Medienfreiheitsgesetz“ – Ursula von der Leyen sichert sich Oberaufsicht über alle Medien in der EU