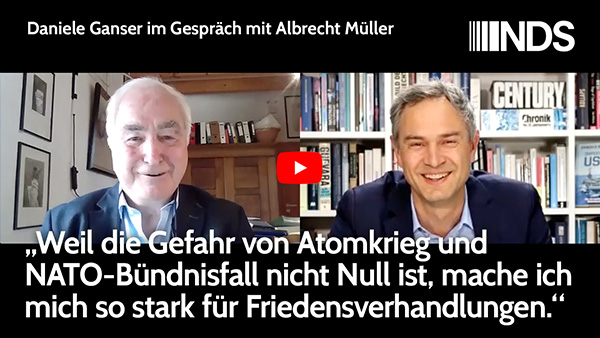Nur einen Tag nach dem blutigen Putsch, am Nachmittag des 12. Septembers 1973, überreichte eine Gruppe von Ökonomen und Unternehmern den Putschgenerälen einen Plan für eine marktradikale Transformation Chiles. Die an der Lehre von Milton Friedman orientierten Maßnahmen waren im sogenannten „Montagsclub“ entstanden – ein Zusammenschluss einflussreicher Unternehmer und Ökonomen, der sich kurz nach dem Antritt von Allende gegründet hatte. Dieser Club hatte seit 1972, in Erwartung eines bevorstehenden Putsches, zielstrebig daran gearbeitet, einen Fahrplan für eine „neoliberale Konterrevolution“ zu erarbeiten. Jetzt war die Zeit der Umsetzung gekommen. Von Florian Warweg.
Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.
Podcast: Play in new window | Download
Das Team des Montagsclubs finanzierte seine Arbeit durch Zuwendungen des chilenischen Unternehmerverbandes, der wiederum von der CIA unterstützt wurde. Dies belegen 2013 freigegebene CIA-Akten. Der im „Montagsclub“ vorherrschende ideologische Gleichklang fand insbesondere darin seinen Ausdruck, dass fast alle Mitglieder über einen Abschluss der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der University of Chicago verfügten.
Friedman trifft auf Pinochet
Es dauerte allerdings noch zwei Jahre, bis Milton Friedman höchstpersönlich Pinochet seine Aufwartung machte und die Diagnose verkündete: Chile brauche eine Schocktherapie oder der Patient werde sterben. Für seine Visite kassierte der Wirtschaftsprofessor aus Chicago ein Honorar von 30.000 US-Dollar. Das Ergebnis des Besuchs konnte sich sehen lassen. Gab es zuvor noch starke Stimmen innerhalb der Militärjunta, insbesondere in der Marine, die sich bis 1975 für die Wirtschaftspolitik verantwortlich zeichnete und die sich für eine gemischte Ökonomie, die auch noch Ansätze der Importsubstitution beinhaltete, aussprachen, war es nach Friedmans Besuch damit vorbei. Pinochet entmachtete die Marine-Vertreter in der Junta, konzentrierte die Macht noch stärker auf sich und machte den Weg frei für die Chicago Boys und deren Idee einer neoliberalen Transformation.
Doch wie kam es überhaupt zu diesem starken Einfluss der Chicagoer Wirtschaftsschule ausgerechnet in Chile? Das ist wenig bekannt und sehr aufschlussreich für das Verständnis, wie langfristig man in Washington an dieser neoliberalen Machtübernahme in Chile gearbeitet hatte.
Die Rolle von US-AID
Von 1956 bis zum Sieg der Unidad Popular 1970 gab es ein umfassendes Austauschprogramm der Wirtschaftsfakultät der University of Chicago mit der Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). Finanziert wurde das Ganze von der Agency for International Development, besser bekannt unter der Abkürzung US-AID. Das Programm hatte explizit einen „systematischen Ideologietransfer“ zum Ziel sowie vor diesem Hintergrund den Aufbau eines neuen wissenschaftlichen Beraterstabs, um die, auch das wurde ganz offen kommuniziert, „vorherrschenden sozialreformerischen Lehrmeinungen“ in Chile zurückzudrängen.
Dieser Ideologieexport zielte vor allem auf Chile. Der Grund hierfür lag auf der Hand. In Chile befand sich seit 1948 der Hauptsitz der UN-Organisation „Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), allgemein unter dem Kürzel CEPAL bekannt. Diese gab damals mit ihren strukturalistischen Analysen über Zentrum/Peripherie – der bekannteste Vertreter war der argentinische Ökonom Raúl Prebisch – und die daraus resultierenden strukturellen Abhängigkeiten im kapitalistischen Weltmarkt die wirtschaftstheoretischen Leitlinien für den ganzen Kontinent vor. Diesen Einfluss und die politökonomische Ausrichtung der CEPAL wollte man mit diesem Programm beenden. Dies gelang allerdings nur bedingt. Denn aus diesen Theorieansätzen der CEPAL entwickelte sich später die sogenannte Dependenz-Theorie, eine der wenigen Großtheorien, die, aus der kapitalistischen Peripherie kommend, bis Ende 1980er-Jahre großen Einfluss auf die Wirtschafts- und Entwicklungsdebatten insbesondere in den USA, der BRD und Frankreich ausübte.
Aber zurück zu den Chicago Boys. US-AID hatte als Träger des Austauschprogramms weder die Católica (bis heute die zentrale Elite-Uni Chiles) zufällig gewählt noch die Chicago School of Economics. Letztere galt seit den 1940er-Jahren als „Trutzburg gegen die Hegemonie der Keynes‘schen Theorien“.
Die „Chicago Boys“ und ihre neoliberale Schocktherapie für Chile
Und hier schließt sich der Kreis. Nach der Visite von Friedman stellten ab 1975 chilenische Absolventen der Chicagoer Schule den Wirtschafts-, den Finanz-, den Planungs-, den Arbeitsminister sowie den Chef der Zentralbank (Man stelle sich dies mal für Deutschland vor: Alle relevanten Ministerposten für den Wirtschafts- und Finanzbereich des eigenen Landes wären ausnahmslos von Absolventen einer einzigen US-Fakultät und Denkschule besetzt).
Auf diese Postenkonzentration der Chicago Boys folgte ein entfesselter Neoliberalismus. So wurden unter anderem, ganz im Sinne der Friedman’schen „neoliberalen Konterrevolution“:
- die Strom- und Wasserversorgung, das Bildungswesen sowie das Gesundheitssystem komplett privatisiert;
- der Bodenmarkt sämtlicher Regulierungen enthoben;
- Steuern und Zölle massiv gesenkt;
- Gewerkschaften und Mindestlohn abgeschafft;
- der Finanzsektor umfassend dereguliert;
- das System der staatlichen Rentenversicherungssystem abgeschafft und durch ein sogenanntes Kapitaldeckungsverfahren ersetzt. Dazu wurden private Rentenfonds gegründet, die sogenannten Administradoras de Fondos de Pensiones, in Chile allgemein als AFP bekannt.
Der Nachtwächter-Staat zahlt seitdem lediglich eine absolute Mindestrente, die umgerechnet zwischen 110 und 230 Euro liegt. Wer von dieser Mindestrente abhängig ist, lebt entweder bei den Kindern oder auf der Straße. Über 70-Jährige weisen in Chile seit den 1980er-Jahren die höchste Selbstmordrate aller Altersgruppen auf, auch im internationalen Vergleich.
Aus dem Norden gab es für all diese Maßnahmen frenetischen Applaus. Das Wall Street Journal empfahl 1980 dem damaligen US-Präsidentschaftskandidaten Ronald Reagan, „diese Jungs“ in die USA zu holen, um auch dort die angeblich so erfolgreiche Schocktherapie durchzuführen. Viele andere stimmten in den Chor ein, selbst in der Rückschau. So erklärte beispielsweise der US-Ökonom und Nobelpreisträger Gary Becker noch 1997 gegenüber der Business Week:
„Die Bereitschaft der Chicago Boys, für einen grausamen Diktator zu arbeiten, war eins der besten Dinge, die Chile je passiert sind.“
In Großbritannien waren ähnlich euphorische Stimmen zu hören. Thatcher und Pinochet bezeichneten sich gar als Freunde, und die britische Premierministerin sollte später alles daransetzen, ihren „dear friend“ vor der ihm drohenden Strafverfolgung und Auslieferung wegen dessen Diktaturverbrechen zu bewahren.
Doch der angebliche wirtschaftliche Erfolg Chiles beruhte fast nur auf Phrasen. Hinter der Fassade des herbeigeschriebenen „lateinamerikanischen Tigers“ herrschten Elend und wirtschaftliche Stagnation:
Das durchschnittliche Wachstum zwischen 1973 und 1990 lag bei knapp 2,9 Prozent. Der Durchschnittslohn sank während der Pinochet-Ära um 50 Prozent im Verhältnis zu 1970. Gleichzeitig stieg der Anteil der Bevölkerung unter der Armutsgrenze dramatisch von 20 Prozent unter Allende auf 44 Prozent in den 1980er-Jahren.
Durch die aufgezählten Maßnahmen sind bis heute die Lebenshaltungskosten in Chile fast so hoch wie in Deutschland, bei weit geringeren Löhnen. Rund die Hälfte der arbeitenden Bevölkerung Chiles verdient weniger als umgerechnet 500 Euro im Monat. Allein für den Weg zur Arbeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ausnahmslos in privater Hand, geben die Menschen durchschnittlich 20 Prozent ihres Einkommens aus, für Lebensmittel zwischen 30 bis 40 Prozent. Ein Großteil des monatlichen Konsums der „Mittelschicht“ beruht auf Kredit. Chile ist infolge der neoliberalen Schocktherapie der OECD-Staat mit der mit Abstand größten sozialen Ungleichheit: Ein Prozent der Bevölkerung verfügt über weit mehr als ein Drittel des Reichtums.
In Chile wurde damit, aus Sicht der Chicago Boys durchaus erfolgreich, experimentiert, wie durch erzwungene Privatisierungen Kapitalakkumulationen generiert werden können, die zur bewussten Umverteilung von unten nach oben führten und die Eliten und ausländische Investoren sehr einseitig bevorzugten. Diese neoliberalen Parameter erfuhren dann später, wie schon erwähnt, in den Modellen der Reaganomics in den USA und des Thatcherismus in Großbritannien eine Fortführung und Weiterentwicklung. Mit rund einem Jahrzehnt „Verspätung“ erfasste dies dann auch die Bundesrepublik. Im Unterschied zu Chile, USA und Großbritannien waren im Falle der Bundesrepublik allerdings Sozialdemokraten und Grüne die endgültigen politischen Vollstrecker…
Leserbriefe zu diesem Beitrag finden Sie hier.
Titelbild: Screenshot vom Dokumentarfilm „Chicago Boys“
Wie die Pinochet-Diktatur in Chile sich auf deutsche Alt-Nazis im BND verlassen konnte
50 Jahre Pinochet-Putsch gegen die Unidad Popular – Lektionen für heute