Austeritätspolitik in Griechenland: Ökonomische Verwüstung statt eines exportgetragenen Wachstums
Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt (oder zumindest unkommentiert) hat sich in der Deutung der systemischen Krise der Europäischen Währungsunion durch den Mainstream eine Akzentverschiebung vollzogen. Als vor einigen Jahren die Schwierigkeiten der EWU offensichtlich wurden, herrschte zunächst weitgehend Konsens, dass es eigentlich gar keine Eurokrise gäbe, sondern lediglich ein Problem zu hoher Staatsschulden einiger kleiner Euroländer, ausgelöst durch ein unverantwortliches staatliches Ausgabeverhalten. So behauptete etwa Bundesbankpräsident Jens Weidmann im Juni 2011: „Die aktuelle Krise ist keine Krise des Euro. Es handelt sich um eine Staatsschuldenkrise einzelner kleiner Länder im Euroraum, die nicht zuletzt durch die Missachtung der Regeln entstanden ist“ (Süddeutsche Zeitung, 14.6.2011). ein Gastartikel von Günther Grunert
Wenig später waren nicht nur die staatlichen Schulden in einigen wenigen südeuropäischen Ländern, sondern die Staatsschulden in Europa generell (und anderswo in der Welt) die Ursache allen Übels. Finanzminister Wolfgang Schäuble drückte es in einem Interview mit dem ARD-Magazin Plusminus im September 2011 wie folgt aus: „Eigentlich ist es unter Ökonomen weltweit unbestritten, dass eine der Hauptursachen – wenn nicht sogar die Hauptursache – der Krise – nicht nur jetzt, sondern schon 2008 – die zu hohe Verschuldung der öffentlichen Haushalte auf der ganzen Welt ist“ (zit. nach Berger 2011).
Inzwischen ist ein Erklärungsstrang hinzugekommen, der zu Beginn keine Rolle spielte, nun aber gleichberechtigt neben den staatlichen Schulden rangiert: die Krise der Wettbewerbsfähigkeit. So stellte Wolfgang Schäuble im Juni 2013 bei „Cicero online“ fest: „Zu hohe Staatsverschuldung und mangelnde Wettbewerbsfähigkeit sind die Ursachen der Krise in Europa.“ Noch deutlicher würde erst jüngst Bundeskanzlerin Angela Merkel in einem Interview mit dem Fernsehsender Phoenix vom 13. August 2013: „Wenn ich mir anschaue, wie die Wettbewerbskraft anderer Länder auf der Welt zunimmt […], dann ist dringend Eile geboten, dass Europa an seiner verbesserten Wettbewerbsfähigkeit arbeitet. […] Wenn sie wettbewerbsfähig sein wollen, dann müssen die Lohnstückkosten in Europa vergleichbar sein. Wenn sie in einem Land viel höher sind, hat das zur Folge, dass das Land seine Produkte nicht mehr verkaufen kann und damit die Arbeitslosigkeit steigt. […] Die Reformen, die wir jetzt (innerhalb Europas; Anm. des Verf., G. G.) verabredet haben […], sind Reformen, die die Lohnstückkosten senken und damit die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen.“
Auch die Troika aus IWF, EU und Europäischer Zentralbank setzt hinsichtlich der Eurozone und insbesondere der Euro-Krisenländer ganz auf die Strategie der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. So schreibt der IWF: „Southern Europe needs to increase competitiveness in the tradables sector, especially through labor market reforms. […] These measures will help reduce unemployment and rebuild competitiveness in the periphery” (IMF 2013a, S. 49). Noch deutlicher wird der IWF in seiner kritischen Analyse des “Rettungsprogramms” Griechenlands: “The program had to work within the constraints of the fixed exchange rate and engineer an internal devaluation. Part of the adjustment in ULCs (= unit labour costs, Anm. des Verf., G. G.) would come from the economic slowdown that would exert downward pressure on wages. The rest would follow from structural reforms that would free up Greece’s rigid labor and product markets and raise productivity” (IMF 2013b, S. 22).
Die Strategie, die Griechenland aufgezwungen wurde, basiert also außer auf staatlichen Ausgabenkürzungen zu einem großen Teil auf einer „internen Abwertung“, d. h. einer allgemeinen Lohnsenkung: Der wirtschaftliche Einbruch sollte einen Abwärtsdruck auf die griechischen Löhne ausüben, unterstützt von Strukturreformen zur „Befreiung“ der rigiden Arbeits- und Produktmärkte Griechenlands und zur Erhöhung der Produktivität. Die Lohnkürzungen – so offenbar die Erwartung – würden die Exportprodukte Griechenlands wettbewerbsfähiger machen, steigende Nettoexporte dann das griechische Wachstum beleben. [1] Die Lösung der Probleme Griechenlands sollte also in einem exportgetragenen Wachstum liegen.
Im folgenden Beitrag wird untersucht, wie erfolgreich diese Strategie der Troika in Griechenland war. Die Fokussierung auf Griechenland (und die damit verbundene weitgehende Vernachlässigung der anderen Euro-Krisenländer) erfolgt aus zwei Gründen: Zum einen ist Griechenland wohl das am meisten von der Austeritätspolitik im Euroraum geschädigte Land (zumindest, was den Einbruch der Wirtschaftsleistung und die Arbeitslosenquote betrifft) und zum anderen wird gerade in Bezug auf Griechenland derzeit viel Optimismus verbreitet: So ist vom baldigen Ende der Talfahrt der Wirtschaft und der Rückkehr des Wachstums die Rede und die griechische Regierung wertet schon einmal die angeblich bevorstehende Trendwende als Bestätigung ihrer Wirtschaftspolitik (Lapavitsas 2013; Hickel 2013).
In Abschnitt 1 werden zunächst die Auswirkungen der Austeritätspolitik auf die griechische Wirtschaft untersucht, bevor in Abschnitt 2 die Außenhandelsposition Griechenlands analysiert wird, auf der die Hoffnungen nicht zuletzt des IWF basieren. Abschnitt 3 zeigt anschließend auf, warum die Strategie eines exportgetragenen Wachstums in Ländern wie Griechenland zum Scheitern verurteilt ist. Abschnitt 4 beendet mit einem kurzen Fazit die Untersuchung.
1. Der Zusammenbruch der griechischen Wirtschaft
Die Austeritätsprogramme in Griechenland umfassen deutliche Kürzungen bei Löhnen, Renten und Sozialleistungen, Steuererhöhungen, die Liberalisierung des Arbeitsmarktes, Privatisierungen öffentlichen Eigentums und Entlassungen im öffentlichen Sektor. Auf den ersten Blick scheinen die drastischen Einschnitte durchaus zu den von der Troika gewünschten Ergebnissen geführt zu haben: Wie aus Abbildung 1 hervorgeht, sind in Griechenland sowohl die Pro-Kopf-Löhne als auch die Lohnstückkosten in den letzten vier Jahren stark gesunken.
Abbildung 1
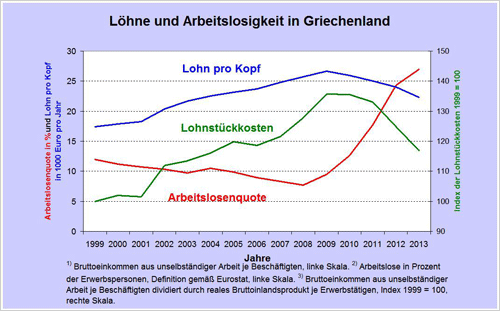
Quelle: Flassbeck 2013a
Die Voraussetzungen für das angestrebte exportgetragene Wachstum waren also scheinbar gegeben und tatsächlich sind die griechischen Exporte seit Beginn der Austeritätsmaßnahmen (in den Jahren 2009 und 2010) gestiegen. Jedoch konnte diese Verbesserung nicht annähernd den immensen Rückgang bei den anderen Komponenten der aggregierten Nachfrage ausgleichen. Wenn – wie in Griechenland – der Staat seine Ausgaben reduziert (und zusätzlich noch Steuern erhöht), führt dies zu negativen Effekten bei den Unternehmen und privaten Haushalten. Diese geben als Folge ebenfalls weniger aus, als sie ursprünglich geplant hatten, so dass es zu einer negativen Gesamtwirkung auf die Volkswirtschaft kommt, die größer ist als diejenige, die allein durch die staatlichen Ausgabensenkungen ausgelöst worden wäre. Diese größere Gesamtwirkung verglichen mit der geringeren Ausgangswirkung wird durch den Multiplikator gemessen. Die Theorie der Troika, dass staatliche Ausgabenkürzungen nur eine geringe Auswirkung auf die übrige Wirtschaft hätten, hat sich als komplett falsch herausgestellt. In Wahrheit führten die staatlichen Haushaltskürzungen zu einem sich beschleunigenden Zusammenbruch beim privaten Konsum und bei den Investitionen. Die EU-Kommission schätzte noch im Frühjahr 2012 den Fiskalmultiplikator, der die Auswirkung des Sparens auf das Wachstum des BIP misst, auf ungefähr 0,5. Demnach würde die gesamte Wirtschaftsleistung nur um 50 Cent fallen, wenn der Staat seine Ausgaben um einen Euro kürzte. [2]
Diese Annahme ist nicht haltbar, wie allein die vielen Fehlprognosen der EU-Kommission belegen: So waren die Ökonomen der Kommission in ihren ersten Prognosen davon ausgegangen, dass das BIP Griechenlands in den Jahren 2011 und 2012 um 0,7 Prozent bzw. 1,1 Prozent steigen würde (Handelsblatt, 10. 12. 2012); tatsächlich aber sank es um 7,1 Prozent resp. 6,4 Prozent.
Papadimitriou et al. (2013) kommen dann auch für Griechenland auf einen Multiplikator-Wert von über 2,5 (d. h. für jeden Euro an Ausgabenkürzungen verliert Griechenland mehr als 2,5 Euro an Wirtschaftsleistung), also deutlich höher als von der EU-Kommission angenommen. Anderen Ökonomen zufolge liegt der Wert für den fiskalischen Multiplikator in Griechenland noch höher, möglicherweise sogar bei 3,6, wie etwa Patrick Artus, der Leiter der Forschungsabteilung der französischen Bank Natixis, annimmt (Handelsblatt, 10.12.2012). Aber unabhängig davon, ob der Multiplikator nun bei 2,5 oder bei 3,6 oder irgendwo
Abbildung 2: Griechenland: Komponenten des BIP
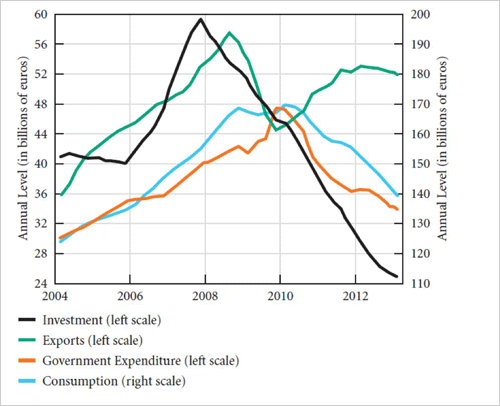
Quelle: Papadimitriou et al. 2013, S. 4
dazwischen liegt – eines ist sicher: Es war das Zusammenwirken von staatlichen Kürzungsprogrammen und Lohnsenkungen, das in Griechenland (und in anderen Euro-Krisenländern) eine fatale Abwärtsspirale in Gang gesetzt hat (Flassbeck 2013b).
Wie aus Abbildung 2 hervorgeht, sind die Investitionen in Griechenland, die in den zwei Jahren vor Beginn der Krise deutlich zugelegt hatten, seit ihrem Höchststand Ende 2007 um fast 34 Mrd. Euro gesunken und erreichen im ersten Quartal 2013 mit nur noch 25 Mrd. Euro ein Rekordtief. Der Konsum in Griechenland, der vor dem Abschwung der wichtigste Bestimmungsfaktor für das Wachstum war, hat seit Anfang 2010 um etwa 30 Mrd. Euro abgenommen. Allein die Exporte stiegen – wie bereits erwähnt – ab Ende des Jahres 2009 an, während sich fast zur gleichen Zeit die Staatsausgaben in die entgegengesetzte Richtung entwickelten; dabei reichte allerdings bislang der Anstieg der Exporte um fast 8 Mrd. Euro seit ihrem Tief nicht aus, um den Rückgang der Staatsausgaben um 13 Mrd. Euro im gleichen Zeitraum auszugleichen.
Vor allem die auf Austerität angelegte Finanzpolitik und die Lohnkürzungen haben also dazu geführt, dass die Wirtschaftsleistung in Griechenland dramatisch eingebrochen ist; sie ist prozentual stärker zurückgegangen als in allen anderen Euro-Krisenländern. Wie aus Abbildung 3 ersichtlich, liegt das griechische BIP jetzt um beinahe 25 Prozent unterhalb seines Vorkrisenniveaus.
Abbildung 3: Entwicklung des BIP in den Krisenländern
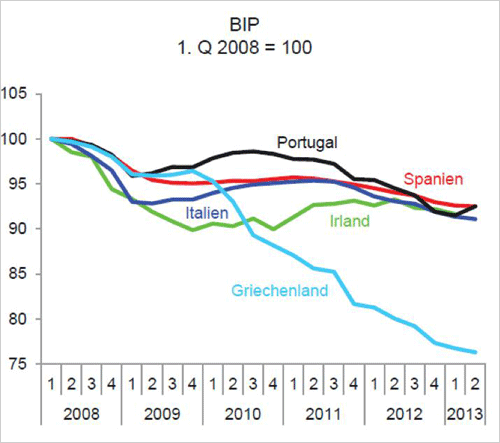
Quelle: Horn et al. 2013, S. 23
Parallel dazu hat sich – wie Abbildung 1 zeigt – die Arbeitslosigkeit seit 2008 sprunghaft erhöht. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote ist nach den neuesten Daten von Eurostat in Griechenland im Juni 2013 abermals gegenüber dem Vormonat gestiegen (wenn auch nur leicht) und beträgt nun 27,9 Prozent; die Jugendarbeitslosenquote liegt im Juni 2013 bei 61,5 Prozent.
Erschreckend ist auch die Entwicklung der Erwerbstätigenquote (Zahl der erwerbstätigen Personen im Alter von 20 bis 64 Jahren dividiert durch die Gesamtbevölkerung derselben Altersgruppe) in Griechenland, die von einem Höchststand von 66,5 Prozent im Jahr 2008 auf nur noch 55,3 Prozent im Jahr 2012 gesunken ist und am Ende dieses Jahres vermutlich noch deutlich niedriger liegen wird. Zu erwarten ist dann eine Quote von rund 50 Prozent, d. h. etwa die Hälfte der Bevölkerung (über 20 Jahre) im erwerbsfähigen Alter wird nicht erwerbstätig sein. Das ist ein außergewöhnlich niedriger Wert für eine entwickelte Nation. Abbildung 4 zeigt den deutlichen Rückgang der Erwerbstätigenquote in Griechenland in den letzten Jahren, der dazu geführt hat, dass Griechenland nunmehr das Schlusslicht unter den verglichenen Ländern bildet.
Abbildung 4: Erwerbstätigenquoten in Prozent in ausgewählten Ländern
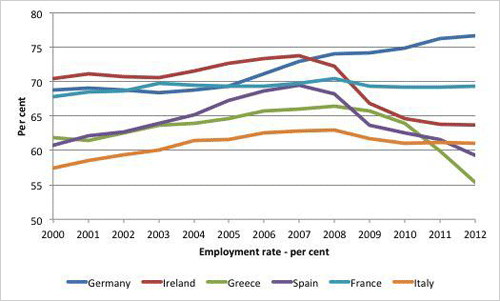
Quelle: Mitchell 2013a
Nun mag die Troika darauf hoffen, dass die Exporte Griechenlands zukünftig weiter ansteigen, was sicherlich nicht auszuschließen ist, obwohl die neuesten Daten eine leichte Abnahme der Ausfuhren seit Ende 2012 anzeigen. Jedoch ist es nicht realistisch, davon auszugehen, dass der Zuwachs der Nettoexporte stark genug sein wird, den Rückgang der anderen Komponenten der aggregierten Nachfrage wettzumachen und schließlich ein aufholendes Wachstum zu erzeugen, das das BIP und die Beschäftigung in Griechenland wieder auf das Vorkrisenniveau zurückbringen würde.
Warum eine solche Entwicklung extrem unwahrscheinlich ist, soll im nächsten Abschnitt gezeigt werden, in dem die griechische Außenhandelsposition genauer untersucht wird.
2. Der griechische Außenhandel
Wie bereits erwähnt, sind die Lohnstückkosten in Griechenland in den letzten vier Jahren deutlich gefallen. Ob dies auch zu einer spürbaren Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit Griechenlands geführt hat, lässt sich anhand der BIZ-Indizes der effektiven Wechselkurse überprüfen, die monatlich von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) publiziert werden (dazu ausführlicher Klau/Fung 2006). Der nominale effektive Wechselkurs einer Währung ist ein Index, der als gewichteter Durchschnitt aus einem Korb von bilateralen Wechselkursen errechnet wird. Wenn der nominale effektive Wechselkurs um eine Messgröße für relative Preise resp. Kosten bereinigt wird, erhält man den realen effektiven Wechselkurs (REER). [3] In den Veränderungen des REER finden mithin sowohl Entwicklungen der nominalen Wechselkurse als auch das Inflationsgefälle gegenüber den Handelspartnern Berücksichtigung. Reale effektive Wechselkurse liefern also eine Messgröße der internationalen Wettbewerbsfähigkeit: Steigt der REER, lässt sich daraus schließen, dass das Land international weniger wettbewerbsfähig geworden ist, sinkt der REER, gilt das Umgekehrte.
Bill Mitchell hat auf Basis der BIZ-Daten ein Schaubild erstellt, das die Veränderungen der realen effektiven Wechselkurse (sog. „enge Indizes“ für 27 Volkswirtschaften) von Januar 2008 (= 100) bis Juli 2013 zeigt – und zwar für ausgewählte Euroländer und den Euroraum insgesamt. Abbildung 5 verdeutlicht, dass die realen effektiven Wechselkurse der betrachteten
Abbildung 5: Entwicklung der realen effektiven Wechselkurse (Index Januar 2008=100)
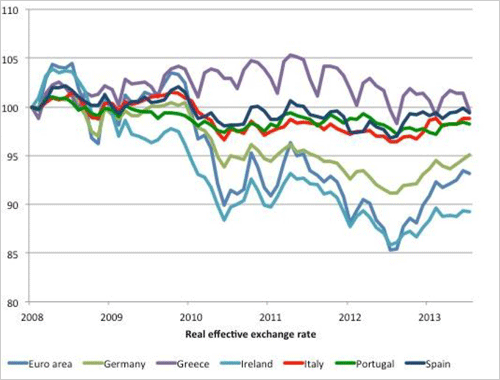
Quelle: Mitchell 2013b
Länder von Beginn der Krise bis Mitte des Jahres 2012 tendenziell gefallen sind und sich seitdem wieder in Richtung ihres Ursprungsniveaus von Januar 2008 zurückbewegen, wenngleich in unterschiedlich starkem Maße.
Der reale effektive Wechselkurs für Griechenland hat sich dagegen im Juli 2013 (Indexwert = 99,6) gegenüber Januar 2008 (Indexwert = 100) praktisch nicht verändert.
Es ist Griechenland also trotz aller massiven Einschnitte und Kürzungen nicht gelungen, seine Wettbewerbsfähigkeit wesentlich zu verbessern. Dies wird auch aus Abbildung 6 deutlich, die die Entwicklung der Handelsbilanz Griechenlands seit 2005 zeigt.
Abbildung 6: Griechenland: Entwicklung der Handelsbilanz
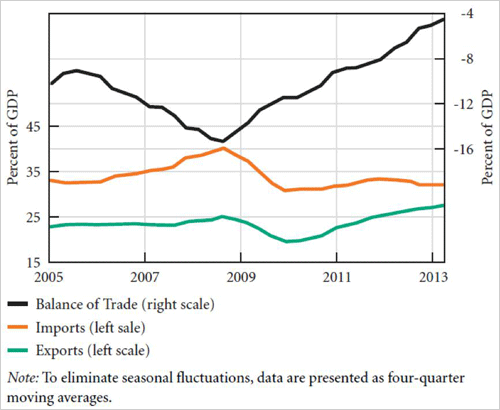
Quelle: Papadimitriou et al. 2013, S. 9
Zwar sind die Warenexporte (in Prozent des BIP) nach ihrem Einbruch im Jahr 2009 wieder angestiegen und liegen nun sogar über dem Vorkrisenniveau. Die Verbesserung der Handelsbilanz ist jedoch in erster Linie den krisenbedingt eingebrochenen Importen geschuldet. Es besteht deshalb die Gefahr, dass sich bei wieder aufkommendem Wachstum das Handelsbilanzdefizit erneut erhöht. Darüber hinaus resultiert der Anstieg der griechischen Warenexporte zu einem beträchtlichen Teil aus einer Zunahme im Wert des griechischen Handels mit raffinierten Erdölerzeugnissen, die wiederum Folge höherer Ölpreise und einer gewachsenen Nachfrage im Zuge der globalen wirtschaftlichen Erholung war (Papadimitriou et al. 2013).
3. Warum die Strategie eines exportgetragenen Wachstums nicht funktioniert
Die Entwicklung Griechenlands zeigt sehr eindrucksvoll, dass die Strategie, über niedrigere Lohnkosten die Exportprodukte zu verbilligen, um über steigende Nettoexporte Investitionen, Wachstum und Beschäftigung zu erhöhen, in den meisten Ländern zum Scheitern verurteilt ist. Dafür gibt es mehrere Gründe:
Erstens ist zwar ein positiver Effekt von Lohnsenkungen auf den Außenhandel durchaus möglich; bei einem großen absoluten Rückstand gegenüber bedeutenden Handelspartnern ist ein Aufholprozess, der mit dem Rückgewinn von Marktanteilen verbunden ist, jedoch schwierig und erfordert Zeit (Handelsströme sind im Allgemeinen relativ träge und reagieren nur langsam auf die verbesserte Wettbewerbsfähigkeit eines Landes). Weit schwerer wiegt aber, dass die Wirkung einer erhöhten Wettbewerbsfähigkeit vom relativen Gewicht des Außenhandels verglichen mit der Binnenwirtschaft bestimmt wird. In einem Land wie Griechenland etwa, das nur einen Exportanteil von rund 25 Prozent am BIP aufweist, schwächt eine Lohnsenkung die wesentlich wichtigere Binnennachfrage weit mehr, als sie den Export zu beleben vermag. Denn in einer (weit überwiegend) binnenwirtschaftlich ausgerichteten Volkswirtschaft führt eine Senkung der Nominallöhne bei (zunächst) nicht sinkenden Preisen und folglich fallenden Reallöhnen zu einer abnehmenden realen Konsumnachfrage der Arbeitnehmerhaushalte [4]. Ein Ausfall bei der realen Gesamtnachfrage würde nur dann nicht eintreten, wenn die Unternehmen unmittelbar nach der Lohnkürzung mehr Arbeitskräfte einstellten, deren Nachfrage den Verlust bei den bereits beschäftigten Arbeitnehmern exakt ausgliche, oder die Unternehmen sofort in Höhe der ausgefallenen Konsumnachfrage zusätzlich investierten oder die Unternehmerhaushalte in entsprechender Größenordnung zusätzlich konsumierten. All dies ist nicht zu erwarten: Denn die Unternehmen erhalten auf ihrem binnenwirtschaftlichen Absatzmarkt durch die fallende Nachfrage der Arbeitnehmerhaushalte und die daraus resultierende sinkende Auslastung der Kapazitäten ein negatives Signal, das ihre Investitionsbereitschaft dämpft und nicht etwa anregt. Mehr als unwahrscheinlich ist auch, dass die Unternehmen bzw. die Unternehmerhaushalte aus einer Situation der Unterauslastung der Kapazitäten heraus sofort damit beginnen, neue Arbeitskräfte einzustellen resp. ihre Konsumausgaben deutlich zu erhöhen, nur weil sich ihre Kostensituation verbessert hat. [5] Ohne nachhaltiges Nachfragewachstum werden die Unternehmen weder ihre Produktion ausweiten noch ihre Investitionen erhöhen, wenn der vorhandene Kapitalstock vollständig ausreicht, die aktuelle (abnehmende) Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen zu befriedigen.
Gehen die Unternehmen schließlich dazu über, mit Preissenkungen auf die Absatzschwierigkeiten bzw. den lohnbedingten Nachfrageausfall zu reagieren – und dies ist ja erwünscht, um die Wettbewerbsfähigkeit des Landes nach außen hin zu verbessern – , verschlimmert das nur die Lage: Denn damit erhalten alle Marktteilnehmer ein Signal zum Abwarten: Konsumenten verschieben Käufe auf die Zukunft, da die gewünschten Produkte bald ja noch preisgünstiger werden; für Sachinvestoren ist bei sinkenden Absatzpreisen die Kalkulationsgrundlage so unsicher, dass sie Investitionsprojekte verzögern – und zwar unabhängig davon, ob und wie sehr sie sich auf der Kostenseite durch die Lohnsenkungen entlastet fühlen. Zusätzlich wird die Investitionsbereitschaft der Unternehmen geschwächt, weil Deflationsprozesse zu einer Erhöhung der Realzinsen und der realen Schuldenlast führen: „Because private financial commitments exist, the burden of inherited debt increases with wage and price deflations. A rise of the burden of debt when price deflation occurs makes borrowers and lenders alike wary of the debt-financing of private spending, and in particular of investment. A decline in investment is a reaction to price deflation” (Minsky 1986, S. 139; dazu auch Minsky 1984, S. 5f). Im Ergebnis bricht die aggregierte Nachfrage massiv ein und die Wirtschaftsleistung geht entsprechend zurück.
Wenn dann auch noch der Staat seine Ausgaben reduziert, also zusätzlich entweder direkt (indem er sich als Investor zurückzieht) oder indirekt (indem er Transfereinkommen kürzt und so die Nachfrage der privaten Haushalte schwächt) die Nachfrage bei den Unternehmen verringert, stürzt die Volkswirtschaft vollends in die Krise, mit allen bekannten Folgen wie einer rasant steigenden Arbeitslosigkeit, einer weiteren Belastung der öffentlichen Haushalte, zunehmenden Kreditausfällen der Banken usw. Das Schlimmste, was der Staat in einer Rezession, die durch einen Einbruch bei den privaten Ausgaben verursacht wird, tun kann, ist, prozyklische Veränderungen in der Fiskalpolitik vorzunehmen, d. h. Veränderungen, die die Gesamtausgaben noch mehr reduzieren. Genau das aber verlangt die Troika von Griechenland.
Woher aber soll das notwendige Wachstum in Griechenland kommen, wenn die Unternehmen nicht investieren, solange der private Konsum schwach ist, die privaten Haushalte aus Angst vor möglicher Arbeitslosigkeit verstärkt sparen und weniger ausgeben, der griechische Staat seine Ausgaben kürzt und alle Krisenländer sich gegenseitig ihre Exportmärkte zerstören?
Zweitens setzt die Strategie eines exportgetragenen Wachstums voraus, dass die Handelspartner mitspielen. Wenn Angela Merkel verlangt, dass „Europa an seiner verbesserten Wettbewerbsfähigkeit arbeitet“, dann kann das nur bedeuten, dass Europa als Ganzes und darunter die EWU (speziell natürlich die südeuropäischen Länder einschließlich Frankreichs) gegenüber dem Rest der Welt wettbewerbsfähiger werden soll, d. h. dauerhaft Außenhandelsüberschüsse gegenüber der übrigen Welt erzielt. [6] Das aber werden die Handelspartner langfristig nicht einfach hinnehmen, sondern sich mit Abwertungen ihrer Währungen oder mit Handelsschranken zur Wehr setzen. Gelänge es tatsächlich, nicht nur in Griechenland, sondern in der gesamten EWU oder sogar in ganz Europa die Lohnstückkosten zu senken, wie es Angela Merkel offenbar vorschwebt, würde dies nur kurzfristig die Wettbewerbsfähigkeit der EWU bzw. Europas gegenüber der übrigen Welt erhöhen (nämlich solange, bis die daraus resultierenden Leistungsbilanzüberschüsse zu einer Aufwertung des Euro führten), aber die Gefahr einer europaweiten Deflationsspirale heraufbeschwören. [7]
Drittens ist noch nicht einmal gewährleistet, dass der Versuch eines Landes, durch eine Senkung der Nominallöhne die für die gesamtwirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit entscheidenden Lohnstückkosten zu senken, im angestrebten Ausmaß gelingt. Denn die Lohnkürzungsstrategie schwächt nicht nur – wie oben gezeigt – die aggregierte Nachfrage, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Produktivitätsentwicklung. Letztere wird negativ beeinflusst, weil die Unternehmen als Reaktion auf den lohnbedingten Nachfrageausfall und die verstärkte Rezessionsphase ihre Investitionen zurückfahren (vgl. auch Abbildung 2). Investitionen aber steigern die Arbeitsproduktivität: Je mehr in neue Fertigungs- und Verfahrenstechniken investiert wird (die primär auf den im Investitonsgüterbereich erzeugten Produktinnovationen basieren), desto moderner ist im Allgemeinen der Produktionsapparat und desto höher ist die Arbeitsproduktivität. Eine abnehmende Investitionstätigkeit schwächt umgekehrt das zukünftige Produktivitätswachstum, so dass unsicher ist, ob die Lohnkürzungsstrategie langfristig tatsächlich zu der anvisierten deutlichen Senkung der Lohnstückkosten führt. [8]
4. Fazit
Die Austeritätspolitik in Griechenland ist gescheitert. Dies nicht nur wegen des massiven Rückgangs des griechischen BIP und der dramatisch hohen Arbeitslosigkeit, sondern auch, weil die Schuldenstandsquote nicht – wie erhofft – gesunken, sondern weiter angestiegen ist, nämlich von knapp 128 Prozent im Jahr 2009 auf nunmehr 180 Prozent (Polychroniou 2013a). Die sozialen Auswirkungen der Austeritätspolitik sind immens: Mehr als 30 Prozent der griechischen Bevölkerung leben inzwischen nahe oder unter der Armutsgrenze. Die drastischen Budgetkürzungen haben dazu geführt, dass das öffentliche Gesundheitswesen vor dem Kollaps steht (einigen Krankenhäusern fehlt es an geeigneten medizinischen Geräten, um bestimmte Operationen durchzuführen oder an Medikamenten, um Krebspatienten behandeln zu können) und die öffentlichen Schulen in einem katastrophalen Zustand sind (viele können sich nicht einmal mehr Heizöl leisten). Die Auswanderung hat stark zugenommen – allein in Deutschland ist die Zahl der Immigranten aus Griechenland zwischen 2011 und 2012 um 73 Prozent gestiegen (Polychroniou 2013b).
Dabei sind es gerade junge, gut ausgebildete Griech(inn)en, die zu emigrieren versuchen. Vor allem die geringqualifizierten Jüngeren, die Arbeitslosen und die Randgruppen wenden sich verstärkt der Neonazi-Partei „Goldene Morgenröte“ zu, die im letzten Jahr bei den Parlamentswahlen 6,9 Prozent der Stimmen erhielt und seitdem mit 18 von 300 Abgeordneten im Parlament vertreten ist. Einer neuen Meinungsumfrage zufolge würde die Neonazi-Partei bei Wahlen derzeit 7,8 Prozent erhalten und damit zur drittstärksten Kraft im Parlament werden (www.taz.de, 8.10.2013). Mit der Wirtschaftskrise findet also rechtsextremes Gedankengut immer mehr Akzeptanz in der griechischen Gesellschaft, woraus eine ernstzunehmende Gefahr für die Demokratie erwächst.
Da Schrumpfungsprozesse nicht ewig dauern, wird natürlich auch die griechische Wirtschaft irgendwann wieder wachsen, wenngleich von einer sehr niedrigen Basis aus. Es ist zu erwarten, dass die Austeritäts-Befürworter dann beim geringsten Anzeichen einer Besserung in lauten Jubel ausbrechen und den Erfolg ihrer Politik verkünden werden. Man müsse halt einen langen Atem haben, strukturelle Reformen brauchten einfach ihre Zeit. Dass der ökonomische Schaden, der in der Zwischenzeit angerichtet wurde, noch Jahrzehnte nachwirken wird, dass man vor allem sehr viele Jahre brauchen wird, um die Zahl der Arbeitsplätze, die in kurzer Zeit vernichtet wurden, wieder aufzubauen, dürfte dann bei den Austeritäts-Anhängern schnell vergessen sein, ebenso wie das menschliche Leid, dass diese absurde Politik ohne Not Millionen von Betroffenen – in Griechenland und in den anderen Euro-Krisenländern – zugefügt hat.
Literatur
Berger, J. (2011): Die Eurokrise in Zahlen (I) – Wie Musterschüler zu Problemkindern wurden, Nachdenkseiten, 1. September; letzter Zugriff: 10.10.2013
Flassbeck, H. (2013a): Griechenland: Ex-Post Evaluation durch den IWF oder wie man an seinen eigenen Vorurteilen scheitert [ABO-Artikel], flassbeck-economics, 11. Juni; letzter Zugriff: 10.10.2013
Flassbeck, H. (2013b): Der Multiplikatorstreit zeigt vor allem eines: Die Dynamik einer monetären Marktwirtschaft ist weiterhin unverstanden, flassbeck-economics, 15. September; letzter Zugriff: 10.10.2013
Hickel, R. (2013): In Hellas viel Asche, aber kein Phönix – Griechenlands Austeritätskrise, Nachdenkseiten, 14. Oktober; letzter Zugriff: 10.10.2013
Horn, G./Herzog-Stein, A./Hohlfeld, P./Lindner, F./Rannenberg, A./Rietzler, K./Stephan, S./Tober, S./Zwiener, R. (2013): Krise überwunden? Prognose der wirtschaftlichen Entwicklung 2013/2014, IMK Report 86
IMF (2013a): World Economic Outlook: Hopes, Realities, and Risks, Washington D.C., April
IMF (2013b): Greece – Ex Post Evaluation of Exceptional Access Under the 2010 Stand-by Arrangement, Washington D.C.; letzter Zugriff: 10.10.2013
Klau, M./Fung, S. S. (2006): The new BIS effective exchange rate indices, in: BIS Quarterly Review, March, S. 51-65
Lapavitsas, C. (2013): Is Greece about to get out of its crisis?, flassbeck-economics, 13. Oktober; letzter Zugriff: 10.10.2013
Minsky, H. P. (1984): Limitations of Monetary (and Fiscal) Policy in an Age of Financial Instability, Hyman P. Minsky Archive, Paper 42; letzter Zugriff: 10.10.2013
Minsky, H. P. (1986): Stabilizing an Unstable Economy, New Haven and London
Minsky, H. P./Whalen, C. J. (1996): Economic Insecurity and the Institutional Prerequisites for Successful Capitalism, Levy Economics Institute of Bard College, Working Paper No. 165; letzter Zugriff: 10.10.2013
Mitchell, B. (2013a): Eurozone production and employment still going backwards; letzter Zugriff: 10.10.2013
Mitchell, B. (2013b): Fiscal deficits in Europe help to support growth; letzter Zugriff: 10.10.2013
Papadimitriou, D. B./Nikiforos, M./Zezza, G. (2013): The Greek Economic Crisis and the Experience of Austerity: A Strategic Analysis, Strategic Analysis, Levy Economics Institute of Bard College, July; letzter Zugriff: 10.10.2013
Polychroniou, C. J. (2013a): Fiscal Sadism and the Farce of Deficit Reduction in Greece, One-Pager No. 43, Levy Economics Institute of Bard College, September 16; letzter Zugriff: 10.10.2013
Polychroniou, C. J. (2013b): A Failure by Any Other Name: The International Bailouts of Greece, Policy Note 6, Levy Economics Institute of Bard College; letzter Zugriff: 10.10.2013
[«1] Dass der IWF bei den Lohnkürzungen ganz auf die Wettbewerbsfähigkeit Griechenlands „nach außen“ setzt, zeigt sich nicht nur daran, dass er eine erhöhte Wettbewerbsfähigkeit im Sektor der handelbaren Güter (also solcher Güter, die exportiert und importiert werden) fordert (s. o.), sondern auch an seiner Klage, dass die Preise nicht in gleichem Ausmaß wie die Löhne gefallen sind: „Prices fell by less than the decline in wages in part reflecting continued rigidities in product markets“ (IMF 2013b, S. 12). Nur wenn man auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit abstellt, ergibt diese Klage Sinn, ansonsten hätte sich der IWF über die Rigiditäten auf den Produktmärkten freuen müssen: Wäre nämlich die Folge der Lohnsenkung eine entsprechende Reduktion des Preisniveaus gewesen, wäre eine Senkung des Reallohnsatzes ausgeblieben. Sinkende Reallöhne sind aber in der neoklassischen Arbeitsmarkttheorie gerade erwünscht, da sie angeblich zu einer Substitution von Kapital zugunsten von Arbeit und damit zu mehr Beschäftigung führen.
[«2] Manche Ökonomen, wie etwa Alberto Alesina der Harvard University, gehen gar von negativen Multiplikatoren aus. Würde man den Staatssektor verringern, gäbe man dem Privatsektor neue Spielräume. Die Vertreter solch abstruser Ideen, die den Fiskalmultiplikator auf nahe Null oder unter Null schätzen, sprechen in diesem Zusammenhang auch von einer „expansiven Austerität“.
[«3] Veränderungen im nominalen Wechselkurs und im relativen Preisniveau müssen kombiniert werden, um Veränderungen in der relativen Wettbewerbsfähigkeit zu ermitteln. Der reale Wechselkurs erfasst den Gesamteffekt dieser beiden Variablen und wird daher zur Messung der Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Handel verwendet.
[«4] Vorausgesetzt ist hier, dass die Arbeitnehmerhaushalte ihre Sparquote nicht verringern.
[«5] Hierbei darf auch nicht vergessen werden, dass die Unternehmen notwendigerweise unter der Restriktion unsicherer Zukunftserwartungen agieren. Selbst wenn ein einzelnes Unternehmen dazu tendierte, aufgrund der Kostenentlastung mehr Arbeitskräfte einzustellen oder zusätzlich zu investieren, so weiß es doch nie, wie seine Konkurrenten reagieren, ob im Fall eigener sofortiger Neueinstellungen auch die anderen Unternehmen des Landes uno actu mehr Personen beschäftigen oder nicht (und Neueinstellungen würden sich aus Sicht eines einzelnen Unternehmens nur dann rentieren, wenn sich alle anderen Unternehmen genauso verhielten, d. h. in gleicher Weise Einstellungen vornähmen), es weiß auch nicht, wie sich die Sparquote der privaten Haushalte entwickelt, es weiß vor allem nicht, ob der Wettbewerb am Gütermarkt es nicht doch nach einiger Zeit zwingen wird, die durch die Lohnkürzung ermöglichte Kostensenkung teilweise oder ganz in den Preisen weiterzugeben. Jedes rational handelnde Unternehmen wird also zunächst abwarten, wie sich die Nachfragesituation entwickelt und wie sich die Lohnsenkung auf seine Gewinne auswirkt. Wenn aber die Unternehmen bzw. Gewinneinkommensbezieher nicht sofort reagieren, sondern sich mit Neueinstellungen, zusätzlichen Investitionen oder zusätzlichem Konsum zunächst einmal zurückhalten, bis sie überzeugt sind, dass sich ihre Gewinnsituation tatsächlich – auch längerfristig – verbessern wird, ist ein Nachfrageausfall unvermeidlich.
[«6] Gelegentlich wird auch eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit aller Euroländer im Handel untereinander gefordert. Das ist natürlich Unsinn, da Wettbewerbsfähigkeit immer ein relatives Konzept ist, d. h. der Gewinn des einen an Wettbewerbsfähigkeit immer den Verlust eines anderen an Wettbewerbsfähigkeit bedeutet.
[«7] Hyman Minsky und Charles Whalen unterscheiden zwischen zwei Wegen zur Wettbewerbsfähigkeit: „In the short run, societies can choose between two routes to competitiveness: a ‘high-performance‘ path and a ‘low-wage’ path. The former involves encouraging firms to compete on the basis of innovation, product quality, and the development of new markets.” Dem steht der “low-wage”-Pfad gegenüber, “ […] a strategy that ultimately leads to an economic disaster as firms engage in a ‘race to the bottom’ “ (Minsky/Whalen 1996, S. 11f). Eine Senkung der Löhne und der Lohnstückkosten in ganz Europa entspräche eindeutig dem “low-wage”-Pfad.
[«8] In die Lohnstückkosten gehen zwei Komponenten ein, einerseits die Geldlöhne, bei deren Anstieg sich auch die Lohnstückkosten erhöhen, und andererseits die Arbeitsproduktivität, bei deren Anstieg die Lohnstückkosten sinken.













